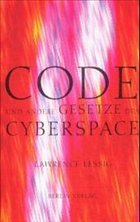Allgemein herrscht die Überzeugung, das Internet, der Cyberspace, könne nicht reguliert werden und sei von seinem Wesen her immun gegen die Kontrolle durch Regierungen oder jeden anderen. Code behauptet, dass dies ein Irrglaube ist. Es liegt eben nicht in der Natur des Cyberspace, unregulierbar zu sein - der Cyberspace hat gar keine "Natur". Er besitzt lediglich einen Code: nämlich die Software und Hardware, die ihn überhaupt erst zu dem machen, was er ist. Dieser Code kann einen Ort der Freiheit schaffen - wie es die ursprüngliche Architektur des Netzes tat - oder aber einen Ort äußerst repressiver Kontrolle. Wenn wir diese Tatsache nicht ernst nehmen, begreifen wir nicht, wie sich der Cyberspace wandelt. Unter dem Einfluss kommerzieller Interessen wird das Internet ein im hohen Maße regulierbarer Raum, in dem unser Verhalten weit schärfer kontrolliert wird als im "wirklichen Leben". In seinem provozierenden und klugen Buch sagt Lawrence Lessig gleichwohl auch, dass diese s Szenario nicht unabwendbar sein muss. Seiner Ansicht nach können, ja müssen wir uns entscheiden, welche Art von Cyberspace wir wollen, und welche Freiheiten darin garantiert sein sollen. Welcher Code soll dort gelten, und wer soll ihn kontrollieren? Die Software als der alles bestimmende Code nimmt geradezu den Rang einer Verfassung ein, einer Verfassung allerdings, auf die bis auf ihre Macher bislang offenbar kaum jemand Einfluss nehmen konnte - und wollte. Dabei ist es die dringende Aufgabe von Juristen, Politikern und jedes einzelnen Bürgers, mit darüber zu entscheiden, welche Werte dieser Code umfassen soll. Diese brillante, bahnbrechende Analyse ist Pflichtlektüre für jeden, der um den Bestand demokratischer Werte im Informationszeitalter fürchtet.

Lawrence Lessig berichtet von der Meinungssteuerung im Internet
Code: in einem übertragenen Sinn sind das sind die Huckel in Tempo-30-Zonen. Jede Architektur ist Code, wenn sie bewusst aber indirekt Verhaltensweisen fördert oder behindert. Meist ist diese Regulierung nicht gesetzlich legitimiert. Zum Beispiel bei den Spiegeln, die uns im Aufzug davon ablenken, über dessen Langsamkeit zu klagen. Lawrence Lessig zeigt, dass das Internet aus solchem Code besteht. Nichts ist da von Natur. Wäre das Netz eine zu beruhigende Tempo-30-Zone, könnte man die Huckel vergessen, in Straßen gleich Loopings einbauen und – wenn eine Burger-Kette zahlt – sie zur Verlangsamung durch ein Drive-In führen. Code gibt seinen Gestaltern alle Freiheit und kann deshalb seinen Nutzern viel Freiheit nehmen. Daher sind Urheberpflichten wichtiger als Urheberrechte.
Lessig hat das schon Ende 1999, als „Code” in den USA herauskam, präzise analysiert. Dass sich an seinem jetzt in Deutschland erschienenen Buch wenig, im Internet aber seitdem sehr viel verändert hat, mindert die Bedeutung seiner eingängig geschriebenen Analyse nicht, sie steigert sie sogar. Denn vieles entwickelt sich so, wie er es damals befürchtet hat. Lessig lehrt Rechtswissenschaft an der Stanford Law School. Folglich ist für ihn das Problematische an Code, dass Unternehmen damit Quasi-Gesetze schaffen können, die laut Lessig zum Teil im Widerspruch zur amerikanischen Verfassung stehen. Code und Recht stehen im Wettbewerb, wobei Code partikulare Interessen durchsetzt. Lessig ist kein Antikapitalist, doch er misstraut einem absolut freien Markt, da dieser zuweilen Grundfreiheiten gefährdet.
Das Recht auf freie Meinungsäußerung zum Beispiel ist durch Filterung von Internetinhalten durch Arbeitgeber, Internet-Provider oder öffentliche Institutionen bedroht. Die enorme und kaum transparente Macht, welche hier die Hersteller von Filtersoftware erhalten, illustriert ein Fall aus dem Frühjahr 2000 stellvertretend für viele andere: Damaligen Berichten zufolge filterte eine von AOL eingesetzte Jugendschutz-Software mit seltsamer Asymmetrie: Der Zugriff aufs „Republican National Comitee” war möglich, der aufs „Democratic National Comitee” hingegen wurde verwehrt. Höchstwahrscheinlich war das lediglich ein Problem unausgereifter Technik, dennoch ist es ein sehr bezeichnendes.
Urheberpflichten tun not
Im Bereich Datenschutz gibt es zahlreiche Beispiele für die Sammelwut vor allem amerikanischer Internetunternehmen. Leider fehlt bei Lessig der Hinweis auf die Relevanz der laxen US-Datenschutzpolitik für Europäer. Die seit vergangenem Jahr geltende „Safe-Harbor-Regelung” zwischen der EU und den Vereinigten Staaten bestimmt, wie US-Unternehmen mit Daten von EU-Bürgern umgehen müssen: Sie haben ihre Datenschutzprinzipien offen darzulegen, allein wenn sie gegen diese selbstauferlegten Prinzipien verstoßen, kann die „Federal Trade Commission” aktiv werden.
Am intensivsten behandelt Lessig die Auswirkungen von Code auf geistiges Eigentum. Seine Prognose: „Für uns beginnt keine Zeit, in der das Urheberrecht stärker gefährdet ist als im realen Raum, sondern eine Zeit, in der das Urheberrecht sich besser schützen lässt als jemals zuvor.” Statt über Urheberrechte müsse über Urheberpflichten gesprochen werden. Über die Pflicht zum Beispiel, das Kopieren und Zitieren für private und wissenschaftliche Nutzung zu ermöglichen. Die Rechte dazu sind sowohl in der amerikanischen Verfassung als auch im deutschen Urheberrecht festgehalten. Und doch spricht einiges für Lessigs Ansicht, dass der Code einiger Unternehmen sich darüber hinwegsetzt. Man kann zum Beispiels DVDs nicht auf Geräten abspielen, deren Hersteller nicht am DVD-Kodierungssystem beteiligt sind und amerikanische DVDs gar nicht in Europa betrachten. Erscheint ein Film also nicht in Deutschland, ist Filmwissenschaftlern eine Einzelbildanalyse anhand der amerikanischen DVD verwehrt.
Lessig präsentiert keine konkreten Lösungsvorschläge, was den Wert seines Buches nicht mindert. Es zeigt den Denkfehler aller Netztheoretiker der ersten Generation, die glaubten, die Struktur des Netzes sei von Natur. Sie ist es nicht. Deshalb plädiert Lessig im Großen und Ganzen für eine stärkere Regulierung durch den Gesetzgeber.
Zwei Dinge sind an dem Buch zu bemängeln. Zum einen fehlt der deutschen Ausgabe jeder Bezug zur europäischen Situation. Es bleibt offen, ob Lessigs Gedankengang sich übertragen lässt. Bis zum 22. Dezember 2002 müssen alle EU-Staaten die Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft in nationales Recht umsetzten. Die Richtlinie sichert – mit gewissen Einschränkungen – das Recht auf freie Werknutzung beim Eigengebrauch und zählt darüber hinaus Ausnahmen vom Vervielfältigungs- und Wiedergaberecht bei 15 weiteren Tatbeständen auf, die zum von Lessig oft erwähnten „fairen Gebrauch” gehören. Allerdings steht die Übernahme dieser Ausnahmen den EU-Staaten frei.
Zum anderen fällt bei Lessigs Gedankengang die übertriebene Polarisierung zwischen Gesetzgeber und Wirtschaft auf. Die momentan größte Bedrohung für „fairen Gebrauch” in den Vereinigten Staaten ist aber nicht fehlende Regulierung, sondern eine Regulierung, die – Lessig zufolge – nicht mit den Grundsätzen der amerikanischen Verfassung übereinstimmt. Der 1998 erlassene „Digital Millennium Copyright Act” verbietet das Umgehen von Kopierschutz. Die Folge ist jedoch nicht die Übersetzung der bestehenden Balance zwischen Urheberrechten und -pflichten, sondern die Unangreifbarkeit von Code.
So verzichten einige amerikanische Informatiker aus Angst vor juristischer Verfolgung auf eine Publikation ihrer wissenschaftlichen Arbeiten. Die EU-Richtlinie enthält ebenfalls eine solche Regelung, die von nationalen Gesetzgebern und Gerichten ähnlich auslegt werden könnte wie in den Vereinigten Staaten. Ein wirklich freier Markt könnte helfen. Denn die Interessen der Medienwirtschaft werden zurecht berücksichtigt, immerhin schützt die amerikanische wie auch die deutsche Verfassung ein Recht auf Eigentum. Nur ist eine Balance nötig, daher muss einigen Unternehmen klar gemacht werden, dass ein Übergewicht des Eigentumsprinzips nicht im Interesse ihrer Kunden ist. Lessig schiebt das Argument des freien Marktes, der ignorante Firmen bestraft, allzu schnell beiseite. Dabei ist die Wirtschaft kein einheitlicher Block. Es gibt Unternehmen, die mit dem Schutz der Privatsphäre Geld verdienen, es gibt junge, innovative Firmen wie Napster, es gibt Hardwareproduzenten mit einem Interesse an einer Balance beim geistigen Eigentum.
Ein freier Markt ist zur Realisierung der von Lessig beschworenen Rechte mindestens ebenso nötig wie staatliche Regulierung. Das Problem dabei: Es ist zumindest fraglich, ob bestimmte Märkte – zum Beispiel der für Musik – angesichts der beherrschenden Stellung einiger Unternehmen überhaupt frei sind. Die Antwort auf diese Frage wäre die zweite Hälfte zu Lessigs so wichtigem Buch. Aber vielleicht hat er sie auch schon geschrieben. Im Oktober erschien in den Vereinigten Staaten „The Future of Ideas”. Darin schildert Lessig, wie alte Industrie-Giganten Innovation verhindern. Bis dahin kann man in „Code” lesen, warum das katastrophal ist.
KONRAD LISCHKA
LAWRENCE LESSIG: Code und andere Gesetze des Cyberspace. Berlin Verlag, Berlin 2001. 493 Seiten, 22,50 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Lawrence Lessig kritisiert die Politik der ruhigen Hand im Internet / Von Milos Vec
Vielleicht ergibt sich der große Reiz dieses Buches daraus, daß es eine alte Frage für ein neues Medium diskutiert. Das Medium ist das Internet, und die Frage lautet: Was ist es, das wir uns vom Staat erhoffen dürfen? Lessigs Frage ist in ihrer Schlichtheit klassisch. Immer schon haben die Staatstheoretiker so gefragt, wenn sie die Souveränität herausgefordert sahen, und immer haben sie Antworten präsentiert, die zwischen den Extremen "Schutz" und "Freiheitsbeschränkung" oszillieren. Lessig beobachtet, wie jene Grundwerte ausgehöhlt werden, die uns im normalen Leben lieb und teuer sind. Die westlichen Verfassungsstaaten verteidigen sie mit einer juristischen Dogmatik und komplizierten Institutionen. Es gibt Verwaltungs- und Verfassungsgerichte, es gibt Kontrollbehörden und die Polizei. Sie sorgen dafür, daß die Balance zwischen Individual- und Gemeininteressen ausgewogen bleibt und daß es Meinungsfreiheit gibt. Im Internet gibt es diese Vorkehrungen nicht.
Lessigs Mängellisten sind alarmierend. Unsere Daten machen uns zu gläsernen Netz-Bürgern. Die Vorstellung von der "Regellosigkeit" des Internets, die die Freiheit garantiere, trifft insoweit noch zu, als nicht der Staat unsere Freiheit beschränkt, aber die Illusion endet hier auch. Die Gefahr kommt von einer anderen Seite. Denn es gibt in diesem Raum einen machtvolleren Akteur als die klassischen Erscheinungen der Staatlichkeit. Es ist der "Code". Als Lessig Mitte der neunziger Jahre mit seinen Vorlesungen zum Recht im Cyberspace begann, war er gerade aus Ost- und Mitteleuropa zurückgekehrt, wo er Verfassungsrecht unterrichtet hatte. Was ihm seine amerikanischen Studenten über den Cyberspace erzählten, glich dem, was er in den postkommunistischen Staaten in Europa zu hören gewohnt war. Die Botschaft lautete: Der Staat ist tot. Für den Cyberspace war dies gleichbedeutend mit der Verheißung der totalen Freiheit. Sie entsprach der politischen Hoffnung der Internet-Gründergeneration. Für Lessig ist dieses Meinungsbild der mittleren neunziger Jahre der zentrale politische Gegner.
Das Werk erschien in den Vereinigten Staaten bereits 1999, und seither mag sich die Stimmung auch dort etwas gewandelt haben. Doch diese zwei Jahre sind nicht die einzige kulturelle Verspätung. Andernorts hat die Gesellschaft die Umstellung, die Lessig rechtspolitisch einklagt, schon früher nachvollzogen. Der Staat ist, zumal bei der Frage der kollektiven Risiken der Technik, in unserer Perspektive längst vom potentiellen Verletzer der Freiheit zu ihrem Garanten geworden: Wir wollen mehr Staat wagen. Neben diesem jüngsten Wandel des Staatsbildes gibt es noch eine zweite Verschiebung, die für die Botschaft des Buches zentral ist. Denn so verspätet Lessigs Plädoyer nach mehr staatlicher Ordnung im Internet rechtspolitisch bisweilen erscheinen mag, so zeitig ist es in technologischer Hinsicht. Denn das Internet hat sich in den vergangenen zehn Jahren auch technisch gewandelt.
Lessig belehrt uns, daß in den vergangenen Jahren das Netz bedenkliche Eingriffe in unsere Grundrechte ermöglicht. So sammeln Anbieter von Online-Communities wie etwa AOL Informationen über ihre Mitglieder. Sie verzeichnen, wo diese sich aufhalten und welche Dateien sie herunterladen. Dies war möglich, da der Staat den Cyberspace weitgehend sich selbst überlassen hat. Die Architekten des Internets haben ihre Konstruktionen als Maßnahmen rein "technischer" Natur ausgegeben. Lessig hält die Zurückhaltung des Staates für gefährlich. Für ihn gibt es keine rein "technischen" Entscheidungen. Der Code - Lessig versteht darunter "die Software und die Hardware, die den Cyberspace zu dem machen, was er ist" - entscheidet über Freiheit, Privatheit, Gemeinwohl. Wir sind für seine Gefahren noch nicht sensibilisiert. Wir sehen nicht die politischen Entscheidungen, die sich mit der Wahl einer bestimmten Netzarchitektur verbinden.
Der Autor muß nach zwei Seiten hin aufklären. Den Verfassungsrechtlern muß er erklären, daß im virtuellen Raum eigene soziale Regeln und technische Regelungen gelten. Der Adressatengruppe der Internet-Bewohner muß er vermitteln, daß jede soziale Gemeinschaft und Technik Probleme aufwirft, die nur das Recht zugunsten des Schwächeren adäquat lösen kann oder zur Vermeidung von Chaos überhaupt regeln sollte.
Lessigs Warnungen beziehen sich keineswegs auf Szenarien, die erst die Zukunft bringen wird. Schon jetzt spürt jeder die Fesseln, wenn er seine Daten bewegt. Vorausgesetzt allerdings, er reflektiert über solche scheinbar nebensächlichen Regeln wie jene des Online-Service-Providers AOL, daß in seinen Chatrooms maximal 23 Personen gleichzeitig anwesend sein dürfen. Zu Recht argumentiert Lessig, daß dies eine Einschränkung der Meinungsfreiheit ist, der wir uns im realen Leben nie fügen würden. Denn sie verhindert organisierten Widerspruch. Sie läßt dem Unzufriedenen nur die Wahl, diesen virtuellen Raum zu verlassen. Lessig will die Rahmenbedingungen der Kommunikation im virtuellen Raum vergesetzlichen. Instanzen, die politisch nicht legitimiert sind, sollen hier nicht regulieren: Der Autor will den Rechtsstaat ins Internet bringen.
Lessig argumentiert über weite Strecken technikhistorisch. Die vielfältigen Ursachen, die die publizistischen Verhältnisse in den Printmedien seit dem späten achtzehnten Jahrhundert verschoben haben, begreift der Autor als exemplarischen Hinweis darauf, daß auch die Steuerungsarchitektur des Internets mit dieser Komplexität von Faktoren arbeiten muß: Der staatliche Einzug sollte nicht nur über Gesetz erfolgen. Indirekt staatlich reguliert werden sollte dieses Medium auch über Markt, Sitte, Moral und technische Normen. Lessig will einen Zirkel aufbrechen, den man gegen staatliche Eingriffe auf diesem Gebiet ins Feld führt: Der Staat könne das Verhalten im Internet nicht regulieren, weil die Architektur des Netzes es nicht erlaube. Die Netzarchitektur zu regulieren sei wiederum unmöglich wegen der Architektur des bestehenden Netzes: ein Kreislauf der Hilflosigkeit.
Tatsächlich liegen die Verhältnisse anders. Effektive Kryptografie kann Privatheit und Vertraulichkeit gewährleisten. Sie kann zudem in einem Medium, in dem es von Fälschungen nur so wimmelt, digitale Identität gewährleisten und Echtheit authentisieren. Die Verschlüsselung als Schlüsselfrage: Wegen dieses doppelten Potentials feiert Lessig die Kryptografie vollmundig als die "wichtigste technische Errungenschaft der letzten tausend Jahre". Wichtig gewiß, aber wichtiger als der Buchdruck? In dieser Euphorie schlägt sich Lessigs erstaunlich ungebrochenes Vertrauen in die Technik nieder.
Ausgerechnet für die technisch verursachten juristischen Probleme neigt Lessig zu technizistischen Lösungen und gerät dabei in einen Widerspruch zu seiner eigenen Analyse, die doch gerade den Technizismus als Problem identifizierte. Er räsonniert über "Durchsuchungstechnologien, . . . so programmiert, daß sie nur Illegales finden". Er empfiehlt "biometrische Verfahren, (die) es möglich machen sollen, einen Menschen mit einem Computer zu verknüpfen". Ein globales, offenes Netz dämmert in Lessigs Visionen auf, beliebige Menschen benutzen beliebige Terminals, "und alles vollkommen sicher, weil unter dem Schutz eines Schlüssels, den Sie in Ihrem Auge tragen". Hier klingt eine Technikbegeisterung durch, die Fehlschläge, Eigendynamik und Mißbrauch der Technik ignoriert.
Lessig empfiehlt zur besseren Durchsetzung unserer Grundwerte den Abschluß von internationalen Verträgen. Könnten sich Staaten nicht, wie Lessig es empfiehlt, wechselseitig zusichern, ihre Regulierungsziele zu unterstützen? Doch die globale Wertepluralität ist groß, zu groß womöglich gerade in den entscheidenden Fragen. In manchen westlichen Industrienationen gilt als Ausübung der Meinungsfreiheit, was der Bundesgerichtshof als "Verbreitung der Auschwitzlüge" für strafbar hält - selbst wenn es von Australien aus durch einen Australier auf einem australischen Server geschieht. Tatsächlich gehen die verschiedenen Nationalstaaten längst eigene und ganz verschiedene Wege bei der rechtlichen Regulierung des Cyberspace. Parallel dazu gibt es ganz verschiedene moralische Grundverständnisse über das Gute und das Rechte. Doch der Begriff "Moral" kommt im Buch nicht vor. Immerhin schreibt Lessig im amerikanischen Original vage von "social norms", ist sich aber wahrscheinlich selbst nicht darüber im klaren, ob er "Moral" oder "Sitte" meint.
Der Autor bettet sich selbst in eine Großthese der Geschichte der Freiheitsbeschränkung ein. Danach bedrohten im neunzehnten Jahrhundert die besagten Normen die Freiheit, Anfang des zwanzigsten sei es der Staat gewesen, Ende des zwanzigsten der Markt und nun der Code. Ihm möchte Lessig, auf die Leistungsfähigkeit des Rechts vertrauend, den entschiedenen Widerstand eines erstarkten Nationalstaats entgegenstemmen. Der Nationalstaat wird nicht an der internationalen Natur und Unregierbarkeit des Internets scheitern, weil es eine solche "Natur" des Cyberspace nicht gibt. Der Staat muß bloß zunächst Regulierungsmacht einsetzen, um seine Regulierungsmöglichkeiten zu verbessern. Die Beziehung zwischen dem Internet und dem Nationalstaat ist keineswegs für letzteren eine einseitige und verhängnisvolle Affäre. Umgekehrt kann der Nationalstaat auch Regierungsmacht aus dieser neuen Technik schöpfen. Wie er auch aus den anderen Techniken zuvor Regierbarkeit gewann.
Lawrence Lessig: "Code und andere Gesetze des Cyberspace". Aus dem Amerikanischen von Michael Bischoff. Berlin Verlag, Berlin 2001. 493 S., geb., 44,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Konrad Lischka äußert sich sehr positiv zu diesem Buch über "Code", wo Lessig über den Zugang übers Internet nachdenkt - und vor allem auch über jene Mächte, die ihn immer restriktiver regeln. Zwar betont er, dass die Studie bereits vor drei Jahren in den USA erschienen ist und sich seither einiges im Internet geändert hat, doch bemerkt er zustimmend, dass sich die Bedeutung der Untersuchung durch diesen zeitlichen Abstand sogar "steigert". Er lobt den Autor dafür, "eingängig geschrieben" und "präzise analysiert" zu haben und er stimmt mit ihm darin überein, dass eine verstärkte "Urheberpflicht" im Netz zu fordern ist: Denn es sei gar nicht wahr, dass Urheberrechte im Netz gefährdet seien, im Gegenteil: Sie würden immer restriktiver geschützt. Was der Rezensent allerdings bemängelt ist der fehlende "Bezug zur europäischen Situation" in der deutschen Ausgabe des Buches. Außerdem überzeugt ihn die "übertriebene Polarisierung", die der Autor zwischen "Gesetzgeber und Wirtschaft" aufbaut, überhaupt nicht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH