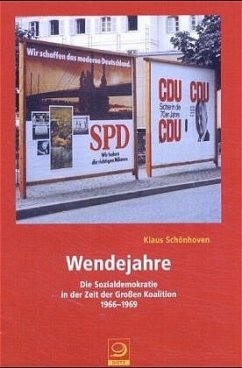Die drei Regierungsjahre der Großen Koalition zwischen 1966 und 1969 waren Wendejahre in der Geschichte der Bundesrepublik mit folgenreichen außen-, sozial- und wirtschaftspolitischen Weichenstellungen.Die drei Regierungsjahre der Großen Koalition von CDU/CSU und SPD (1966?1969) waren jenseits des 'Mythos 1968' eine Phase der Neuorientierung in wichtigen Politikfeldern. Klaus Schönhoven analysiert die Wendejahre der jungen Bundesrepublik: Während die Unionsparteien sich immer weniger als unangefochtene Regierungsmacht verstehen konnten, formulierte die Sozialdemokratie auf ihrem Weg zur linken Volkspartei bereits das Leitmotiv der sozial-liberalen Koalition: 'Wir schaffen das moderne Deutschland'. Wegen der spannungsreichen Konkurrenz beider Volksparteien und Widerständen in den eigenen Reihen konnten nicht alle Pläne verwirklicht werden. Aber es gelang doch, ambitionierte Reformprojekte umzusetzen: die Arbeits-, Ausbildungs- und Berufsbildungsförderungsgesetze, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und die Reform der Finanzverfassung. Diese Monografie basiert auf vielen bislang unbekannten Quellen. Sie beschreibt einen Paradigmenwechsel, der weitreichende Folgen für die gesamte Politik der Bundesrepublik haben sollte.

Die SPD als Regierungspartei in der Großen Koalition während der Jahre 1966 bis 1969
Klaus Schönhoven: Wendejahre. Die Sozialdemokratie in der Zeit der Großen Koalition 1966-1969. Verlag J.H.W. Dietz Nachf., Bonn 2004. 734 Seiten, 58,- [Euro].
Die Begeisterung unter den Genossen hielt sich in Grenzen, als CDU/CSU und SPD im Spätherbst 1966 die Große Koalition bildeten. Siebzehn Jahre nach Gründung der Bundesrepublik nahmen Anfang Dezember erstmals Sozialdemokraten als Bundesminister am Kabinettstisch Platz. Dabei hätte nicht nur der SPD-Vorsitzende Willy Brandt schon damals eine - rechnerisch mögliche - Regierungsbildung mit der FDP bevorzugt. Ende Oktober waren die Liberalen aus der von Ludwig Erhard schlecht geführten kleinen Koalition mit den Unionsparteien ausgestiegen.
Nicht einmal das Auswärtige Amt strebte Brandt ursprünglich an, allenfalls wollte er das Forschungsministerium übernehmen, weil es ihm mehr Zeit für die Parteiarbeit gelassen hätte. Daher telegraphierte der Philosoph Karl Jaspers an den zögerlichen SPD-Chef am 26. November: "Herr Brandt, wenn Sie verzichten, haben Sie Ihr Leben verworfen, Deutschland abgeschrieben und Europa begraben." Auch mit dem neuen Regierungschef Kurt Georg Kiesinger, der aus Stuttgart nach Bonn wechselte, war Brandt nicht ganz zufrieden. Aus der eigenen Lebensgeschichte als linkssozialistischer Emigrant und Hitler-Gegner verständlich, hätte er Eugen Gerstenmaier als Kanzler bevorzugt. Dieser war ein "Mann des 20. Juli" gewesen, während Kiesinger - NSDAP-Mitglied seit 1933 - im Zweiten Weltkrieg als stellvertretender Leiter der Rundfunkabteilung des Auswärtigen Amts nationalsozialistische Auslandspropaganda mitgestaltet hatte. Solche Bedenken lagen dem früheren Weltkriegsoffizier Helmut Schmidt und dem moskauerfahrenen ehemaligen KPD-Führungskader Herbert Wehner fern. Beide Sozialdemokraten gehörten vielmehr seit langem zu den Architekten einer Großen Koalition.
Schmidt war es, der die Sorgen der SPD-Fraktion im Bundestag darüber, daß die Sozialdemokraten vielleicht zum Juniorpartner der Unionsparteien degradiert werden könnten, weil die CDU/CSU ein Bundesministerium mehr als die SPD erhielt und damit im Kabinett durch Regierungschef Kiesinger über eine Mehrheit von elf zu neun Stimmen verfügte, Ende November 1966 rigoros vom Tisch wischte: "Die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers sollte man innerhalb einer Großen Koalition nicht überschätzen. Es gibt keine Richtlinien gegen Brandt und Wehner." Und natürlich erst recht keine gegen Schmidt, obwohl er im Gegensatz zu Wehner, der das Ressort für gesamtdeutsche Fragen übernahm, nicht einmal als Minister zum Zuge kam. Dafür war der Hamburger Politiker mit großer Neigung zu dem - an die CDU gefallenen - Verteidigungsministerium fest entschlossen, "die Regierung vom Parlament aus in Gang zu halten, aber sie auch zu kontrollieren". Das schrieb er einem Freund und setzte selbstbewußt hinzu, daß er es "für eine falsche Rangskala" halte, ein Ministeramt höher als ein parlamentarisches Amt zu bewerten. Ein solches Selbstverständnis von der Kontrolle der eigenen Regierung, die sich theoretisch auf über neunzig Prozent der Bundestagsmandate stützen durfte, teilte Schmidt mit Rainer Barzel, dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, der unionsintern bei der Wahl des Kanzlerkandidaten durchgefallen und ebenfalls nicht mit einem Ministerposten bedacht worden war.
Klaus Schönhoven hat für seine hervorragende, durch Distanz und Nüchternheit bestechende Darstellung der SPD in den Jahren der Großen Koalition die umfangreichen Bestände des Bonner Archivs der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung akribisch ausgewertet, aber auch die des St. Augustiner Archivs für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie relevante Nachlässe im Koblenzer Bundesarchiv umfassend einbezogen. In acht wohlproportionierten Kapiteln sind die Quellenmassen gebannt. Ihnen ist stets eine konzise, höchstens zwei Druckseiten umfassende Zusammenfassung vorangestellt. Die darin angesprochenen Ergebnisse und Probleme werden in jeweils drei bis vier umfänglichen Unterkapiteln vertieft, so daß über die eigentliche Parteigeschichte hinaus eine Art Handbuch über die Geschichte der Bundesrepublik während der Regierung Kiesinger/Brandt entstanden ist. Es fehlt allerdings ein Sachregister - und das schlappe Personenregister verzichtet nicht nur auf Funktionen oder auf Lebensdaten, sondern auch auf schüchterne Ansätze einer sachlichen Untergliederung. Wem nützen 177 Seitenangaben zu "Brandt, Willy", die sich höchstens durch ein "f." und ein "ff." unterscheiden?
Die Etappen der Annäherung von SPD und CDU/CSU seit der späten Adenauer-Zeit zeichnet der Autor gekonnt nach. Ende 1962 scheiterte das von Wehner favorisierte Projekt einer Großen Koalition unter anderem daran, daß die SPD-Bundestagsfraktion Anstoß nahm an einer Fortführung der Kanzlerschaft Adenauers ohne konkrete Befristung und an einer Einführung des relativen Mehrheitswahlrechts auf Bundesebene. Eine Änderung des Wahlrechts, die sowohl in der CDU/CSU als auch in der SPD Befürworter und Gegner hatte, spielte 1966 wieder eine Rolle: "Während für die eine Seite" - so Schönhoven - "die Verständigung auf die Einführung des relativen Mehrheitswahlrechts nach britischem Vorbild der eigentliche Zweck einer Großen Koalition war, argumentierten die Gegner dieser einschneidenden Gesetzesänderung mit verfassungsrechtlichen und politischen Bedenken und setzten auf Zeitgewinn." In den Koalitionsverhandlungen kam es jedoch zu keinerlei konkreten Absprachen, so daß die Parteien während der dreijährigen Regierungszeit immer weiter von der Zielvereinbarung einer Verfassungsänderung für ein neues Wahlrecht ab 1973 und eines Übergangswahlrechts für 1969 abrückten. Denn ein Abschied vom Verhältniswahlrecht gefährdete jene Abgeordneten, die 1965 nicht mit einem sicheren Direktmandat in den Bundestag eingezogen waren. Dazu meint Schönhoven: "Neben den persönlichen Konsequenzen, die sich daraus für Mandatsträger ergeben konnten, die ihren Parlamentssitz einer guten Plazierung auf den Landeslisten zu verdanken hatten, waren mit einer Wahlrechtsreform auch brisante politische Konsequenzen für regionale Parteigliederungen in Diasporagebieten verbunden. Während man in der CDU vor allem über Mandatsverluste in industriellen Regionen und in Großstädten diskutierte, befürchteten die Sozialdemokraten, in der agrarisch und kleinstädtisch geprägten Provinz politisch auszutrocknen und keine Abgeordneten mehr in den Bundestag entsenden zu können."
Im Unterschied zu einer Reihe von zeitgenössischen Politikwissenschaftlern, die einen fundamentalen Verfassungswandel befürworteten, interessierten die meisten Politiker der Großen Koalition nach Schönhovens Recherchen weniger die prinzipiellen Argumente zugunsten einer Wahlrechtsreform - auch wenn sie vielleicht einsahen, daß ein relatives Mehrheitswahlrecht die Parteienzersplitterung eindämmen, Radikalisierungstenzen wie den sich in den Landesparlamenten bereits vollziehenden Aufstieg der NPD kanalisieren und die unterschiedlichen Rollen von Regierung und Opposition in das Zentrum des Regierungssystems rücken könnte: "Eine Große Koalition war auch aus der Sicht der Politiker immer eine Ausnahmekonstellation und eine Interimslösung, aber sie schreckten davor zurück, das bundesrepublikanische Konsensmodell durch ein Konfliktmodell nach dem Muster der britischen Westminsterdemokratie abzulösen." In ihrem Denken und Handeln spielten - so Schönhoven - binnenorganisatorische Probleme und die regionale Repräsentanz der Parteien, der Zugang zur Politikgestaltung in der Regierung und zu den Koalitionsmöglichkeiten im Parlament die herausgehobene Rolle.
Die insgesamt positive Bilanz der Jahre 1966 bis 1969 stellt das vorschnelle Verdikt des Schriftstellers Günter Grass in Frage, der Brandt noch unmittelbar vor der Bildung der Großen Koalition in einem Brief beschworen hatte, "diese miese Ehe" nicht einzugehen. Trotz der andauernden Konkurrenz von Union und SPD verbucht der Historiker als gemeinsame Erfolge unter anderem die Reform des politischen Strafrechts, die Arbeits-, Ausbildungs- und Berufsbildungsförderungsgesetze, das Lohnfortzahlungsgesetz, das Arbeiter und Angestellte im Krankheitsfall gleichstellte, und die seit mehr als einem Jahrzehnt überfällige Verabschiedung der Notstandsgesetze - obwohl ein Viertel der SPD-Abgeordneten bei der entscheidenden Abstimmung im Bundestag mit Nein votierte: "Die gegen den massiven Widerstand eines heterogenen Protestbündnisses aus Gewerkschaftlern, Wissenschaftlern, protestantischen Pastoren und Studenten schließlich durchgesetzten Notstandsgesetze forderten der SPD-Führung eine geradezu grenzenlose Geduld im Umgang mit den Notstandsgegnern in den eigenen Reihen ab, aber auch das völlige Ausreizen der Kompromißfähigkeit der Unionsparteien im monatelangen Pokerspiel um einen gemeinsamen Gesetzesentwurf. Rückblickend wird man feststellen können, daß die Gegner der Notstandsgesetzgebung die Gefährdung der Demokratie durch diese Ausnahmerechte maßlos überschätzten, während die Politiker der Großen Koalition die Gefahr einer Erschütterung der Bundesrepublik durch innere Unruhen zu stark dramatisierten. Beide Denkweisen wurzelten in der Weimarer Vergangenheit und in den Lehren, die man daraus zog. Für die einen war die Weimarer Republik durch Ausnahmerechte zugrunde gerichtet worden, für die anderen hatte sie als streitbare und wehrhafte Demokratie versagt."
Als "viel zu schmal" habe sich die Basis der Gemeinsamkeiten in der Ost- und Deutschlandpolitik erwiesen. Durch die ablehnende Haltung der Unionsparteien gegenüber einer Anerkennung des Status quo in Europa und einer Hinnahme der deutschen Gebietsverluste im Osten, einer Preisgabe der Hallstein-Doktrin und des Bonner Alleinvertretungsanspruchs sowie einer Respektierung der deutschen Zweistaatlichkeit habe erst die im Oktober 1969 zustande gekommene SPD/FDP-Koalition die "Phase des lähmden Stillstandes" beendet, der ab 1968 zum außenpolitischen Kennzeichen der Großen Koalition geworden sei. Verstärkt worden sei dieser Stllstand durch die fast geschlossene Frontstellung der CDU/CSU gegen den Nichtverbreitungsvertrag für Atomwaffen, während die SPD mit der bundesdeutschen Unterschrift einen entspannungspolitischen Brückenschlag über die Blockgrenzen hinweg habe signalisieren wollen. Die Unterzeichnung im Spätherbst 1969 interpretiert Schönhoven vielleicht begrifflich etwas überzogen als "Akt der außenpolitischen Selbstbefreiung von überkommenen Dogmen und Doktrinen", eng verbunden wiederum "mit der Selbstanerkennung der Bundesrepublik als westdeutscher Teilstaat sowie mit der Hoffnung auf einen dauerhaften Wandel des Ost-West-Verhältnisses, ohne den eine Überwindung der von der DDR aufgetürmten zwischendeutschen Barrieren undenkbar war". In dieser "Selbstbefreiung" sei die Epochenbedeutung des Regierungswechsels von 1969 und der Bildung der Regierung Brandt/Scheel vor allem verankert.
Schönhovens Studie kann schließlich der Debatte um die vorerst gescheiterte Föderalismusreform historische Tiefe geben. Denn dem Leser werden anschaulich die Vorgeschichte und die lebhaften Diskussionen in der Koalition und innerhalb der SPD über die Finanzverfassungsreform nahegebracht. Ende der sechziger Jahre ging es darum, die jeweiligen Aufgaben der verschiedenen bundesstaatlichen Ebenen zu definieren, die Gemeinschaftsaufgaben festzulegen, den vertikalen und horizontalen Finanzausgleich neu zu gestalten sowie die Gemeindefinanzen zu ordnen. In diesem Zusammenhang nennt Schönhoven das im Mai 1969 verkündete Finanzreformgesetz "eine der Glanzleistungen" der Großen Koalition, weil es damals offenkundige Mängel beseitigt habe. Damit sei gleichzeitig der Grundstein gelegt worden für die "definitive Etablierung der Verhandlungsdemokratie" in der Bundesrepublik, die zum dauerhaften Erbe der Großen Koalition gehöre. Jedoch fällt er über die langfristigen Folgen zu Recht ein vernichtendes Urteil: "Die Einführung der Mitfinanzierung von Länderaufgaben durch den Bund und der Mischfinanzierung zwischen Bund und Ländern höhlte die Autonomie der Gliedstaaten aus und schuf für den Bereich der Gemeinschaftsaufgaben eine Grauzone der gemeinsamen Verantwortung. Ohne Bundeshilfe konnten die Länder fortan Engpässe in der Infrastruktur, im Bildungswesen oder in der Krankenhausversorgung nicht mehr beseitigen, während die Ausweitung der zustimmungspflichtigen Gesetze das Mitregieren der Länder im Bund auf immer größer werdenden Politikfeldern möglich machte. Die Folge war eine Durchdringung und Überlagerung des Bundesstaates durch den Parteienstaat, wobei sich die Konturen von Regierung und Opposition bei der Kompromißsuche in den Vermittlungsinstanzen des Verbundföderalismus immer mehr verwischten."
RAINER BLASIUS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Eine Studie zur viel geschmähten Großen Koalition
Große Koalitionen gelten nicht als besonders „sexy”. Sie sind die Ausnahme von der Regel des parlamentarischen Wettstreits, eine Notlösung aus dem Zwang der Wahlarithmetik oder eine Antwort auf eine besonders schwierige politische Phase. Nicht viel anders lauteten auch die Vorbehalte gegen die bisher einzige Große Koalition auf Bundesebene in den Jahren zwischen 1966 und 1969: „20 Jahre verfehlte Außenpolitik, so Günter Grass in einem erzürnten Brief an Willy Brandt, „werden durch Ihr Eintreten in eine solche Regierung bemäntelt.” Diese „miese Ehe” werde in die „lähmende Resignation” führen und die Politik der SPD „für Jahrzehnte ins Ungefähre” münden lassen.
Dass solche Ängste an der Realität vorbeigingen, zeigt der Mannheimer Zeithistoriker Klaus Schönhoven in seinem eindrucksvollen Buch. Im Rückblick kann sich die Leistungsbilanz der Großen Koalition durchaus sehen lassen: Sie regelte die bundesstaatliche Finanzverfassung neu, liberalisierte, getragen vom Resozialisierungsgedanken, das Strafrecht und bediente sich umfassender keynesianischer und korporatistischer Steuerungsmodelle, um die ersten Krisen des Arbeitsmarktes oder den „Bildungsnotstand” zu bewältigen.
Zugleich legten die Großkoalitionäre und insbesondere die Sozialdemokraten einen besonderen Akzent auf die Expansion sozialstaatlicher Leistungen: Mit dem Gesetz über die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wurden Arbeiter und Angestellte sozialversicherungsrechtlich gleichgestellt - womit die einstigen Proletarier „nicht mehr Menschen zweiter Klasse” waren, wie der DGB-Vorsitzende Heinz-Oskar Vetter in einem Brief an Helmut Schmidt zufrieden feststellte. Der Fraktionschef und spätere Kanzler gehörte auf Seiten der SPD zusammen mit Herbert Wehner zu den Architekten der Koalition, die sie auch gegen Widerstände ihrer Partei und anfängliche Vorbehalte Brandts
erfolgreich durchsetzten. Vor allem Schmidt war es auch, der trotz erheblicher innerparteilicher und gewerkschaftlicher Proteste gegen die umstrittenen Notstandsgesetze seine Fraktion zusammenhielt und hinter den Kulissen Krisenmanagement betrieb.
Die SPD präsentierte sich als innovative und verlässliche Regierungspartei. Das Reservoir an Übereinstimmung mit der CDU/CSU in Fragen der inneren Liberalisierung und außenpolitischen Entspannungspolitik hatte sich aber 1969 erschöpft. Das lag nicht zuletzt daran, dass sich die SPD in einem tiefgreifenden Wandlungsprozess befand, wie Schönhoven eindringlich zeigt. Schon seit den sechziger Jahren hatte sich mit der Veränderung der Erwerbsstruktur auch das soziale Profil der Partei zu verändern begonnen. Die klassischen Arbeitermilieus hatten ihre alte Bindungskraft verloren. Dafür sprach die SPD immer mehr Menschen an. Sie wurde jünger und akademischer, wobei sie in den sechziger Jahren noch immer eine weitgehend patriarchalische Organisation blieb - woran sich lange kaum etwas änderte. Nicht mehr vorwiegend die Industrie- und Facharbeiter prägten das Ortsvereinsleben; neue Gruppen kamen vor allem in den Großstädten hinzu: die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes, die Beamten und Studenten. Deren neomarxistische Sozialismus-Exegese polarisierte die Partei, zwang sie zugleich aber, neue Antworten auf die Generationsprobleme und die programmatischen Herausforderungen einer zunehmend pluralisierten Gesellschaft zu geben - ein notwendiger wie schmerzhafter Prozess.
Waffenstillstand auf Zeit
Schönhovens überzeugende Studie, die auch im aktuellen Wahlkampf von Interesse sein kann, benennt die Schwierigkeiten der SPD in der Regierung, ihre Wahlniederlagen in den Ländern, die gescheiterten Initiativen und Konflikte - und ist damit weit entfernt von einer Glorifizierung der Partei. Und doch lässt er keinen Zweifel: Die Große Koalition war mehr als eine Verlegenheitslösung oder Phase des Übergangs. Sie bedeutete einen „politischen Waffenstillstand auf Zeit”, der neue Formen der Konsensbildung zwischen Bund und Ländern ermöglichte. Gleichzeitig bedeuteten die drei Jahre eine „Scharnierzeit” in der Geschichte der Bundesrepublik, in der sich gesellschaftliche Veränderungen beschleunigten und länger bestehende politische und wirtschaftliche Probleme gelöst werden mussten.
Kurt-Georg Kiesinger und Willy Brandt, das ehemalige NSDAP-Mitglied und der politisch Verfolgte, bildeten ein Bündnis, das deutlich machte, wie erfolgreich parlamentarische Konsensfindung auf Zeit sein kann. Ein Befund, der in der jetzigen Debatte um den „Standort Deutschland” wie ein Stück aus einem fremden Universum klingt - und deshalb umso lesenswerter ist.
DIETMAR SÜSS
KLAUS SCHÖNHOVEN: Wendejahre. Die Sozialdemokratie in der Zeit der Großen Koalition 1966-1969, J.H.W. Dietz Nachf., Bonn 2004. 734 Seiten, 58 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Rezensent Rainer Blasius findet diese "hervorragende" Darstellung der SPD in den Jahren der Großen Koalition besonders auf Grund ihrer Distanz und Nüchternheit bestechend. In acht "wohlproportionierten Kapiteln", denen stets "eine konzise, höchstens zwei Druckseiten umfassende Zusammenfassung" vorangestellt sei, habe Klaus Schönhoven die "Quellenmassen" gebannt, deren versierte Durchforstung dem Rezensenten ebenfalls sichtlich Respekt abnötigt. Die in den Kapiteln angesprochenen Ergebnisse und Probleme werden zur Freude des Rezensenten außerdem in jeweils zwei bis drei "umfänglichen" Unterkapiteln weiter vertieft, so dass aus seiner Sicht mit diesem Buch über die Parteigeschichte hinaus gleichzeitig eine Art Handbuch über die Geschichte der Bundesrepublik während der Regierung Kiesinger/Brandt entstanden ist, dass noch gegenwärtig relevanten Aspekten wie der gescheiterten Föderalismusreform historische Tiefe zu geben vermag. Der Rezensent bedauert allerdings das Fehlen eines Sachregisters. Auch das Personenregister ist für seinen Geschmack durch das Fehlen von Funktionen, Lebensdaten der darin aufgeführten Personen sowie einer sachlicher Untergliederung ein wenig "schlapp" ausgefallen.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"