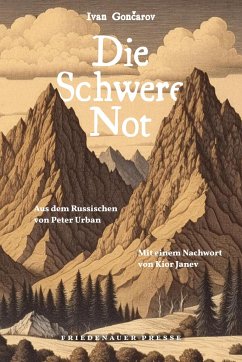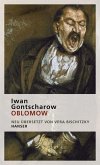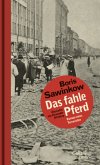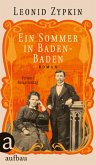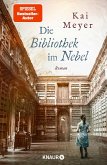Mit dem Frühling erwacht bei einigen Bewohnern Petersburgs ein seltsames, überaus dringliches Verlangen: eine unstillbare Sehnsucht nach frischer Luft und unberührter Natur, die die im Winter so kultivierten Herrschaften um den Verstand bringt und unwägbaren Gefahren aussetzt. Während ihrer rastlosen Spaziergänge stürzt die betroffene Familie Zurov in Schluchten, wird von Hunden überfallen, erblindet und ertrinkt beinahe im See. Ausgerechnet der faule Tjazelenko, der die meiste Zeit im Bett verbringt und deshalb vor der Ansteckung der saisonalen Seuche bewahrt bleibt, diagnostiziert der Gesellschaft ein schreckliches Leiden, dessen Ursache er zu kennen meint. Da seine Glaubwürdigkeit mehr als fragwürdig ist, beschließt der Erzähler, besorgt um das Wohl seiner Freunde in der Großstadt, der Sache selbst auf den Grund zu gehen - und die Zurovs auf einen ihrer verhängnisvollen Ausflüge zu begleiten.Heute, da das Zelt oder die Hütte in freier Natur der Sehnsuchtsort manch eines Städters ist, liest sich Die Schwere Not aktueller denn je. Geschrieben im Geiste Gogols ist die Erzählung zugleich eine herrliche Parodie auf das so beliebte Genre der romantischen Naturdichtung, indem sie uns vor Augen führt, welche Gefahren bei Picknick und Spazierfahrt auf uns lauern.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
In Ivan Gončarovs Debütroman liest Urs Heftrich Gegenwärtiges. Der Bewegungsdrang und die Flucht ins Grüne hätten die postpandemische Welt erfasst, wie damals Gončarovs aufgeklärte Zeitgenossen, die nach westlicher Gewohnheit an Wanderlust und Hyperaktivismus erkrankt seien. So sehr die wiederentdeckte Erzählung des russischen Autors wie eine Apologie der städtischen Muße wirkt, so dynamisch ist sie dennoch. Der Rezensent erkennt darin einen Kulturkampf, Gončarov verteidigt die Möglichkeit des Selbstgenusses in der Stadt und blickt zugleich skeptisch auf die Suche nach Muße auf dem Land. Ulrich befindet, dass dieses Frühwerk "in sich ruht" und hochaktuell ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Wenn plötzlich jeder wandert, kann man von einer Seuche sprechen: Ivan Goncarovs Erstlingswerk "Die Schwere Not" wird wiederentdeckt.
Wandern ist zum Volkssport geworden. Offenbar hat uns der stachelige kleine Covid dazu angestachelt; seit Ausbruch der Corona-Epidemie treibt es die Gesundheitsfexe ins Freie. Aber wer schützt jetzt die kranken Wälder gegen diesen Sturm von Wanderern? Doch der Wald darf aufrauschen: Ein wortmächtiger Verbündeter eilt ihm zu Hilfe - wenn auch "eilen" die Sache nicht ganz trifft. Denn der Retter ist Ivan Goncarov, schwerleibiger Erschaffer eines heillos verfettenden Helden namens Oblomow. 1838, gut zwanzig Jahre vor dem Erscheinen des Romans "Oblomow" und sieben Jahre, nachdem die Cholera Moskau heimgesucht hatte, veröffentlichte Goncarov seine erste Erzählung. Wobei auch "veröffentlichen" die Sache nicht ganz trifft, da der Text nur in einer handkopierten Hauspostille kursierte. Der Titel des Debüts klingt bedrohlich: "Die Schwere Not". Wie auch nicht, geht es doch um eine Epidemie. Aber nicht um die Cholera, sondern um die Epidemie des Wanderns.
Deren Symptome sind erschreckend. Befallene erkennt man an "einem unnatürlichen Glanz" in den Augen, "konvulsivischen Zuckungen" der Gliedmaßen, die "eine unwiderstehliche Leidenschaft für Spaziergänge" entfachen: "Sobald in ihnen auch nur der Gedanke aufblitzt an Wälder, Felder, Sümpfe, abgeschiedne Plätze, treten alle die Symptome ein, und sie befällt die Schwermut und ein Zittern, eh sie nicht ihren armen Wunsch erfüllt: Sie hasten ins Freie, Hals über Kopf, ohne Rücksicht, greifen kaum das Allernötigste; sie sind dann wie Getriebene, gejagt von allen Höllenteufeln." Der Zwang zum Wandern ist unbezähmbar, seine Auswirkung auf das Befinden dramatisch: Schlafmangel, Hunger und Durst, Gewichtsverlust, bei Schlechtwetter auch noch Durchnässung. "Die blassen, ausgezehrten Gesichter, die wirren Haare, verklebten Münder und trüben Augen" - Goncarovs Aufzählung liest sich, als hätte er Hermann Buhls Foto nach der Rückkehr vom Gipfel des Nanga Parbat vorhergesehen.
Es könnte einen schwindeln angesichts solcher Manie der Motorik, gäbe es da nicht den ruhenden Gegenpol in Gestalt des adipösen Nikon Tjazelenko, der im Russischen sein Gewicht schon im Namen trägt ("tjazelyj" heißt schwer). Ein ruhender Pol, buchstäblich: Die kleinen Mahlzeiten nimmt Tjazelenko grundsätzlich nur im Bett zu sich. Beim Frühstück, bestehend aus einem tellergroßen, von einem Kranz Eier gesäumten Roastbeef, einer dampfschiffartigen Tasse Schokolade und einer Flasche Porter, warnt Tjazelenko den Erzähler vor dem Ansteckungsrisiko der Wanderitis.
Natürlich ist er kein ganz unparteiischer Diagnostiker, dieser Vorläufer des Oblomow. Der Erzähler schwankt denn auch in einer Äquidistanz zwischen solch bettlägeriger Nichtstuerei und dem Hyperaktivismus in Wanderstiefeln, zu dem ihn seine übrigen Freunde beschwatzen wollen. Damit parodiert er eine Pendelbewegung, die die ganze russische Kulturgeschichte durchzieht. Die Trägheit, im Westen hektisch als eine der sieben Todsünden gegeißelt, fand im Osten immer schon gelassene Befürworter. Der Recke Ilja Muromez hockt dreißig Jahre lang unbewegt auf dem Fleck, bevor er plötzlich eine immense Kraft in sich aufsteigen fühlt; der russische Bär zeigt ähnliche Verhaltensmuster. Erst mit Peter, dem reiselustigen Zaren, den man den Großen nennt, gerät die Muße in Verruf. Aber die Romantiker rehabilitieren sie: "O komme Trägheit! Komm in meine Klause!", ruft der siebzehnjährige Puschkin.
Goncarov, seinerseits eher behäbig, bezieht in diesem Spannungsfeld eine ambivalente Position. Das zeigt nicht erst der "Oblomow", sondern schon "Die Schwere Not". Was diesen humoristischen Erstling, der streckenweise noch Etüdencharakter trägt, als Werk eines künftigen Meisters ausweist, ist die frappante Originalität, mit der er sein Thema aufgreift: die Muße. Die Tradition will sie seit jeher auf dem Lande finden und flieht deshalb die Stadt.
Der junge Goncarov stellt dieses Muster auf den Kopf, besser gesagt vom Kopf aufs Hühnerauge. Bei ihm ist die Welt noch im Lot, solange man im verschneiten Petersburg zu Hause beisammensitzt, "die Zigarre und ein Glas erkalteten Tees in Händen". Dabei vergehen die "Winterabende wie im Fluge mit Tanz, mit Musik, vor allem aber dem literarischen Vortrag, mit Gesprächen über Literatur und Künste". Mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühling wird hingegen der Erreger der "Schweren Not" aktiv und hetzt alle Infizierten wie besessen ins Grüne. Die City als Oase der Ruhe, die Natur als betriebsamer Hexenkessel: Es brauchte einen Schwerenöter der Trägheit wie Goncarov, um diese Verkehrung des überlieferten Schemas zu ersinnen.
Der 2013 verstorbene Peter Urban, über Jahrzehnte der wichtigste Ausgräber vergessener russischer Literatur, hat diesen kleinen Schatz noch gehoben und, wie stets, mit einem präzisen Kommentar und Nachwort versehen. Bei dem zweiten, von Regine Kühn virtuos übertragenen Paratext von Kior Janev fragt man sich indes, ob dessen Verfasser womöglich selbst der Manie des Umherschweifens erlag und bei einer Hungerattacke am Wegrand wahllos Pilze aß. Er halluziniert Verbindungen zwischen der "Schweren Not" und Vladimir Nabokovs "Zauberer" herbei, die sich dem nüchternen Blick nicht erschließen. Aber einen Ivan Goncarov vermag nichts zu erschüttern. Sein Frühwerkchen ruht in sich selbst und ist aktueller denn je. URS HEFTRICH
Ivan Goncarov: "Die Schwere Not". Eine Erzählung aus Sankt Petersburg im Jahre 1838.
Aus dem Russischen und hrsg. von Peter Urban. Nachwort von Kior Janev. Friedenauer Presse, Berlin 2024. 137 S., br., 20,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main