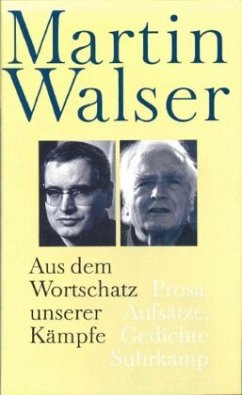Aus dem Wortschatz unserer Kämpfe dokumentiert in verschiedenen, jeweils durch Gedichte getrennten Werkblöcken eine repräsentative Auswahl aus Martin Walsers Erzählungen, seinen "Liebeserklärungen" an Autoren vergangener Zeiten, seinen Essays und Reden über Deutschland und die deutsche Vergangenheit sowie seiner neuesten Essays zur poetischen und sprachlichen Selbstvergewisserung. Eine in die Besprechung des Briefwechsels zwischen Rudolf Borchardt und Rudolf Alexander Schröder gekleidete Hommage an die Freundschaft, die hier zum ersten Mal in voller Länge vorgelegt wird, beschließt den Band.
Zwanglos, also mit Sprüngen vor und Sprüngen zurück, ergibt sich so auch eine chronologische Anordnung: Werkphasen zeichnen sich ab. Gerade an den kleineren Formen wird deutlich, dass sich wohl die Zugangsweisen und Verfahren ändern, die Themen und die Sprache Walsers jedoch einen einzigen großen Klangraum bilden und, dass sich Walser mit seinem Gespür für verdeckte Machtstrukturen immer treu ge blieben ist.
Martin Walser hat diesen Querschnitt durch sein Gesamtwerk mit Texten aus fast fünfzig Jahren eigens für diesen Band komponiert, der so zu einem Selbstporträt eines der bedeutsten Autoren unserer Zeit wird.
Zwanglos, also mit Sprüngen vor und Sprüngen zurück, ergibt sich so auch eine chronologische Anordnung: Werkphasen zeichnen sich ab. Gerade an den kleineren Formen wird deutlich, dass sich wohl die Zugangsweisen und Verfahren ändern, die Themen und die Sprache Walsers jedoch einen einzigen großen Klangraum bilden und, dass sich Walser mit seinem Gespür für verdeckte Machtstrukturen immer treu ge blieben ist.
Martin Walser hat diesen Querschnitt durch sein Gesamtwerk mit Texten aus fast fünfzig Jahren eigens für diesen Band komponiert, der so zu einem Selbstporträt eines der bedeutsten Autoren unserer Zeit wird.

Fünfzig Jahre mit Martin Walser: Ein Lesebuch als Selbstporträt
Man muß Martin Walser nicht mögen. Es ist sogar leicht, ihn nicht zu mögen. Seine Romane kann man je nach Geschmack zu bieder oder zu sarkastisch finden, seine Lyrik etwas harmlos, seine Dramen sekundär; und als politischer Intellektueller hat er ja eigentlich immer eine verläßlich schlechte Presse gehabt, von der linken Jugend bis ins konservative Alter. Wer die Reiz-Reaktions-Mechanismen des öffentlichen Geredes studieren möchte, findet in den Walser-Debatten der in diesem neuen Lesebuch dokumentierten Jahrzehnte einen idealen Anschauungsfall. Wenn aber das nicht schon für ihn spräche, dann täten es jedenfalls diese Texte selbst, die annähernd fünfzig Jahre umspannen: die als Gliederungsmarken gesetzten Gedichte, die erzählende Prosa und vor allem die Reden und Essays. Denn zusammen ergeben sie das Selbstporträt eines Lehrers, der als Schüler auftritt - was ihm oft so überzeugend gelingt, weil er sich tatsächlich als Lernender durch die Welt und die Bücher bewegt. Nein, man muß auch diesen Walser nicht mögen. Aber es macht Spaß, mit ihm zu denken.
Daß der Essayist Walser ein Meister der pointierten und rhythmisch eleganten Formulierungen ist, der augenöffnenden Metaphern und verblüffenden Wendungen, das ist eine triviale Wahrheit. Aber daß er ein Trickser der Sanftmut sein kann, das zeigt erst dieser Band in Lebensgröße. Wie Walser seine Provokationen im Tonfall eines leisen, aber energischen Aufbegehrens vorbringt, etwas kokett zögernd: das macht einen Charme aus, der kritische Leser besonders zuverlässig zur Zustimmung verführt. Wer könnte diesem so umsichtig fragenden, spielerisch erwägenden, so liebenswürdig und selbstkritisch nachdenkenden Herrn etwas abschlagen? Immer gibt er nur zu bedenken, stellt er lediglich anheim, möchte er "die Vermutung nähren, daß" - kann man zarter auf seiner Meinung beharren?
Die vertrackte Harmlosigkeit der Fragen und Bedenken aber ermöglicht das Reden über das denkbar heikelste Thema, das hier im Laufe der Texte als das zentrale seines Lebenswerks hervortritt. Und das ist der versuchte Rückweg in eine "deutsche Nation", die hier ganz romantisch als Gegenwelt der Poesie gerechtfertigt werden soll, gegen alle Schrecken des Eises und der Finsternis.
Ganz beiläufig wird sie eingeführt, im Reden über Goethes Gedichte. Daß diese Verse "fast nicht wie von einer einzelnen Person zu sein scheinen", darin wird ihm jeder leichthin zustimmen können. Doch worauf er hinauswill, das ist nicht der Dichter, sondern Deutschland: "Da scheint doch die Seele eines ganzen Volkes volltönend vor sich hinzusinnieren." Mit dem umgangssprachlich verkleideten Volksgeist ist Walser beim beseligenden "wir" angekommen, das nun ein über Jahrhunderte identisches Kollektiv rhetorisch umfaßt: "Die Gefühlsechte seiner Gedichte", heißt das mit einer kalkuliert frivolen Reklame-Anspielung, "hat sie ja zu Schlagzeilen unserer Seelengeschichte gemacht." Da umstehen die saloppen Floskeln das zentrale Wort wie beschützende Ritter eine reine Jungfrau.
Goethe ist nicht der einzige Held dieser Seelengeschichte. Auch Heine wird liebevoll porträtiert, unauffällig begleitet von George; Hölderlin und "Mein Schiller" treten auf. Aber die prophetische Zentralgestalt bleibt doch der eine Nationaldichter. Liebevoll und eigensinnig malt Walser das Bild Goethes als eines heilenden Klassikers, als habe er es eben erst entdeckt. In Goethes Romanwelt "greifen die Zahnräder auf das glimpflichste ineinander", ihre Handlung vollzieht sich "in schönen, nie zu jähen, immer zwischen Zielstrebigkeit und Streckengenuß sich wiegenden Wendungen"; "vielleicht war er voller Lösungen, für die er dann Konflikte suchte". Es lacht einem das Herz bei solchen Sätzen. Und sie müssen nicht einmal wahr sein, um den Leser zu betören.
Antwort auf das Entsetzen,
daß Gott fehlt
Mitten ins Lachen hinein aber läßt Walser die sanfte Heiterkeit umschlagen in Weltangst. Mit dem von einem anderen Schutzheiligen gelernten bösen Blick liest er der klassischen Schönheit Goethes, wie Nietzsche der griechischen Klassik, den Schmerz ab, dem sie sich verdankt: "wie grell das bloße Dasein auf ihn ohne seine Schönheitsschutzwehr gewirkt haben muß". Das ist ein Satz von autobiographischem Gewicht. In seiner Büchnerpreisrede hat Walser 1981 als ein Grunddatum seiner Biographie wie seiner Zeit die "Leereerfahrung" beschrieben, "daß Gott fehlt" - "jeder Gott", hat der enttäuschte Marxist hinzugefügt. Es könne "eine Art Heilsbedürfnis" sein, das ihn zu Goethe ziehe, sinniert er ein Jahr später, sehr zu Recht. Deshalb endet sein Essay mit dem Staunen darüber, "wie Goethe sich sträubt gegen die Sinnlosigkeit. Wie schön er sich sträubt. Schon das ist sinnvoll. Etwas Schönes ist überhaupt sinnvoll." Deshalb beschwört er mit Schuberts "Kyrieeleison-Jubel" die "Entfaltung eines Daseinsschmerzes auf eine genießbare Art. Mehr kann es nicht geben. Muß es nicht geben." Weil es aber um Himmels willen eben doch mehr geben soll, deshalb macht er die Künstler zum Sprachrohr der Volksseele. Die romantische Nation der Poesie: das ist, mit wechselnden Akzenten auf der Poesie oder der Nation, Walsers Antwort auf das Entsetzen, daß Gott fehlt.
Es ist ein langer Weg von den rebellischen Texten der frühen Jahre zu dieser kunstfrommen Altersweisheit. Das Selbstporträt, als das Martin Walser diesen Band komponiert hat, liest sich wie die Geschichte eines erfolgreichen Coming-out, an dessen vorläufigem Ende der Held sich in der Gesellschaft von Borchardt und Schröder wiederfindet, in deren Freundschaftsbund er wirklich einen schönen Dritten abgeben würde. Man sieht es auch hier, wie beim gernzitierten Namensvetter Robert Walser, den Wegen am Abendlicht an, daß es Heimwege sind.
Das Deutschland, in das sie führen, sieht so aus, wie Walsers Texte klingen. Fränkisch sieht es aus, ein bißchen altfränkisch und sehr schwäbisch. Wer das nur für eine biographische Prägung hält, greift zu kurz. Walsers deutsches Herz schlägt im romantischen Kernland, zwischen Hohenstaufen und Hölderlin, zwischen Wolfram und Wackenroder. Walsers Deutschland ist eine Heimat, die nicht ganz von dieser Welt ist und ihm in die schwäbische Kindheit schien, mit Hölderlin auf dem Dachboden und dem Blick durch die Luke auf den weiten Bodensee und der Sehnsucht nach "Heimkunft". Man muß auch diese Sehnsucht nicht einmal mögen, um sie zu verstehen, um vielleicht sogar von ihr gerührt zu werden.
Nicht glauben, folgen, mögen, sondern: lesen
Da die Unschuld sich aber, wenn überhaupt, allein durch das Aussprechen der Schuld hindurch für weiteren Gebrauch retten läßt, redet Walser so eindringlich von "Auschwitz", daß es manche Kritiker beschämen müßte. Auch dies jedoch geschieht in Sätzen wie dem, "daß wir zur Volksgemeinschaft der Täter gehören". Da ist es wieder, das Walsersche "wir", mit dem bösen Naziwort verhakt zu einer verwirrenden Wesenheit. "Kein Deutscher kann", dekretiert der Nachdenkliche verblüffend kategorisch, "sich über den Lagerboden erheben und sagen, seine Landsleute, die hier gewirkt haben, seien Psychopathen oder Spezialisten gewesen, mit denen habe er nichts zu tun."
Aber ja doch, gewiß kann ein Deutscher das sagen, und mitnichten müßte daraus eine kaltschnäuzige Ablehnung der ererbten Verantwortung folgen. Walsers Gedankengang verschweigt die Prämisse, auf die es ihm doch ankommt: das Postulat jener einen Nationalseele, die auch aus Goethe sang. Weil ihm die Ablehnung des Kollektivsubjekts "deutsches Volk" zugunsten jener Kombination aus Regionalismus und Europäertum, die andernorts gerade als Errungenschaft der Nachkriegsdeutschen gefeiert worden ist, als das ganz Verächtliche erscheint: deshalb muß er sich mit den Mördern in Auschwitz so selbstquälerisch und tapfer identifizieren, wie er es, unter dieser Bedingung, mit Goethe und Hölderlin will.
Die Einwände liegen nahe und werden doch nicht berührt. Man könne aus einer Nation nicht "austreten wie aus einem Verein", bemerkt Walser 1993. Sehr wahr; aber wie liest sich der Satz für jene, die gerade den Fortbestand des Vereins bestreiten? Daß ein gegenwärtig lebender Deutscher nicht den "Faust" für sich reklamieren kann, ohne auch die Schuld an "Auschwitz" mitzutragen, das leuchtet ein. Aber was, wenn jemand auch schon den "Faust" gar nicht für sich reklamieren wollte? Vielleicht klingen auch deshalb manche der Walserschen Selbstvorwürfe so heftig, daß man sie ihm nicht recht glauben mag. Er glaubt sie sich dann auch selber nicht. "Es dürfte", proklamiert er im Auschwitz-Aufsatz 1979, "keine Fächergruppe geben, die uns das, was getan wurde, in einem Ursache-Wirkungs-Zusammenhang begreiflich machen" könnte.
Vierzehn Jahre später hat sich dieser ehrenwerte Unfug, im Angesicht der Skinheads, stillschweigend korrigiert: "Weil ich den Rechtsextremismus lieber auf greifbare und begreifbare Ursachen zurückführe, halte ich nichts von Dämonisierung." Man liest es mit derselben Dankbarkeit wie fast alles, was Walser über die neuen Rechtsradikalen schreibt und was an Klugheit und Mut dem gleichkommt, was Böll seinerzeit zur RAF geschrieben hat. (Kläglicherweise sind auch die öffentlichen Reaktionen dieselben.)
Gewiß, in manchen späten Passagen bleibt von der umwegigen, ausweichenden Denkbewegung nur das Ausweichen übrig. Dann wird eine Frage, aller betonten Dringlichkeit zum Trotz, nicht beantwortet, sondern bloß suspendiert. Und manchmal fällt der Nuancierte unter sein Niveau und gerät ins Schwadronieren. "Sobald man über ein Buch oder über ein Gedicht eine Meinung hat, ist das Buch oder das Gedicht aller weiteren Wirkungsmöglichkeiten beraubt." Daß das bei Lichte besehen Unsinn ist, zeigt niemand einleuchtender als der Schreiber selbst.
Vielleicht mußte Walser, wie Thomas Mann einmal über Fontane bemerkt hat, erst ein älterer Herr werden, um ganz er selber zu sein. Er, der die Vielstimmigkeit der Romane so nachdrücklich dem Reden in eigener Sache vorzieht, mußte sich erst als Essayist porträtieren, um ganz in seinem Tonfall anzukommen. Man muß ihm gar nichts glauben, man muß ihm nicht folgen, und man muß ihn nicht einmal mögen. Man sollte ihn nur lesen. Und es könnte gar nicht schwerfallen, die "Philippsburger Ehen" und den ganzen "Anselm Kristlein" und vielleicht sogar das "Fliehende Pferd" ein wenig beiseite zu legen für dieses Lesebuch.
Martin Walser: "Aus dem Wortschatz unserer Kämpfe". Prosa, Aufsätze, Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002. 440 S., geb., 19,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Zum 75. Geburtstag spendiert Suhrkamp Martin Walser einen Band mit vom Autor selbst ausgewählten eigenen Texten. Rezensent Peter Hamm schreibt dem Jubilar eine standesgemäß umfangreiche und festliche Besprechung, die zum Rückblick auf Leben und Werk wird. Viel geht es um das Verhältnis des Essayisten und der öffentlichen Person Walser zum Schriftsteller. Während er als dieser, meint Hamm, sich immer in all seinen Widersprüchen auf die Figuren aufteilen konnte, habe er, gegen seinen vielfach erklärten Willen, als jener immer wieder das Problem bekommen, auf eindeutige Positionen festgelegt zu werden. Das beklagte "Reizklima des Rechthabenmüssens" hat Walser selbst, bedauert Hamm, nicht immer meiden können. So findet sich in diesem Band viel Essayistisches, auch die berüchtigte Friedenspreisrede. Daneben aber auch Lyrik, die der Rezensent nicht weltbewegend findet, aber doch, gelegentlich, "berührend". Überrascht ist Hamm, dass nur ganz frühe Prosa den Weg in das Buch gefunden hat, der man anmerke, dass Walser seinen Ton da noch nicht gefunden hatte. Interessant aber findet er das Buch allemal, und er wünscht, zum Geburtstag sozusagen, dass sich die Leute an das halten, was Walser etwas barsch befiehlt: "Wer mich nicht liebt, der darf mich auch nicht beurteilen."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH