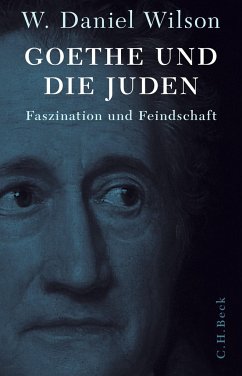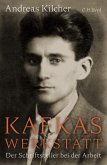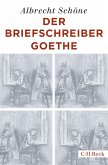GOETHES DUNKLE SEITE
Goethe und die Juden - das heikle Thema wurde allzu lange gemieden. Dabei war Goethes Verhältnis zu den Juden seiner Zeit mehr als zwiespältig. Neben einer gewissen Faszination standen Vorurteile und - besonders in Goethes späteren Jahren - eine regelrechte Feindschaft, die er jedoch bewusst kaum öffentlich äußerte. Auf Grund von bisher ungenutzten Quellen deckt der bekannte Goethe-Forscher W. Daniel Wilson diese schwierige Seite von Goethes Leben und Wirken auf.
«In Jena darf nach alten Gesetzen kein Jude übernachten. Diese löbliche Anordnung dürfte gewiß künftig hin besser als bisher aufrecht erhalten werden.» So schrieb Goethe 1816 in einem Brief. In seinen öffentlichen Äußerungen und Tätigkeiten stellte er sich meist als Freund der Juden dar, auch um seine vielen jüdischen Verehrer und Verehrerinnen nicht zu verlieren. Doch besonders ab 1796 ging er in harte Opposition gegen die Emanzipation der Juden. Diese Haltung stand auch nur scheinbar in Widerspruch zu seinen freundschaftlichen Kontakten mit einigen gebildeten Juden. Im zeitgenössischen Kontext fragt W. Daniel Wilson, wie Goethes Einstellungen zu bewerten sind und wen er überhaupt als «Juden» betrachtete. Wilson zeigt uns den Schriftsteller und Politiker, denn Theaterdirektor und den Privatmann Goethe und zeichnet ein differenziertes Bild, das dennoch klare Urteile nicht scheut.
275. Geburtstag am 28. August 2024 Ein lange gemiedenes Thema in der Beschäftigung mit Goethe W. Daniel Wilson wertet bisher kaum beachtete Quellen aus
Goethe und die Juden - das heikle Thema wurde allzu lange gemieden. Dabei war Goethes Verhältnis zu den Juden seiner Zeit mehr als zwiespältig. Neben einer gewissen Faszination standen Vorurteile und - besonders in Goethes späteren Jahren - eine regelrechte Feindschaft, die er jedoch bewusst kaum öffentlich äußerte. Auf Grund von bisher ungenutzten Quellen deckt der bekannte Goethe-Forscher W. Daniel Wilson diese schwierige Seite von Goethes Leben und Wirken auf.
«In Jena darf nach alten Gesetzen kein Jude übernachten. Diese löbliche Anordnung dürfte gewiß künftig hin besser als bisher aufrecht erhalten werden.» So schrieb Goethe 1816 in einem Brief. In seinen öffentlichen Äußerungen und Tätigkeiten stellte er sich meist als Freund der Juden dar, auch um seine vielen jüdischen Verehrer und Verehrerinnen nicht zu verlieren. Doch besonders ab 1796 ging er in harte Opposition gegen die Emanzipation der Juden. Diese Haltung stand auch nur scheinbar in Widerspruch zu seinen freundschaftlichen Kontakten mit einigen gebildeten Juden. Im zeitgenössischen Kontext fragt W. Daniel Wilson, wie Goethes Einstellungen zu bewerten sind und wen er überhaupt als «Juden» betrachtete. Wilson zeigt uns den Schriftsteller und Politiker, denn Theaterdirektor und den Privatmann Goethe und zeichnet ein differenziertes Bild, das dennoch klare Urteile nicht scheut.
275. Geburtstag am 28. August 2024 Ein lange gemiedenes Thema in der Beschäftigung mit Goethe W. Daniel Wilson wertet bisher kaum beachtete Quellen aus
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Eine detaillierte Auseinandersetzung mit Goethes Verhältnis zu Juden und dem Judentum legt W. Daniel Wilson hier vor, so Rezensent Alexander Kosenina. Die Untersuchung widmet sich drei unterschiedlichen Feldern, lernen wir, den privaten Äußerungen des Schriftstellers, seinen Handlungen in offiziellem Auftrag, sowie seinem Werk. Durchweg sichtbar werden dabei, resümiert Kosenina, Ambivalenzen: Goethe äußert teilweise Bewunderung für das Judentum, oft aber auch Abscheu, als geheimer Rat wendet er sich gegen jüdisch-christliche Mischehen, verteidigt aber auch jüdische Reisende gegen Anfeindungen. Insgesamt argumentiert Wilson laut Kosenina, dass Goethes harsche Attacken gegen Juden vor allem in privaten Äußerungen zu finden sind, während er sich in der Öffentlichkeit und auch in seinem Werk lieber als Humanist präsentieren wollte. Wobei auch das Werk, stellt der Rezensent mit Wilson klar, nicht frei ist von antisemitischen Stereotypen. Insgesamt beschreibt Wilson Goethe zufolge als einen durchaus typischen Deutschen seiner Zeit, was seinen insgesamt abwertenden Blick auf das Judentum angeht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Wie judenfeindlich war Johann Wolfgang von Goethe?
W. Daniel Wilson hat alle Quellen geprüft – und liefert eine Antwort.
Am 23. September 1823 notierte Goethe in seinem Tagebuch: „Abends Canzler von Müller; über Christen- und Juden-Heirathen, unerfreuliche Unterhaltung.“ Hinter diesen kargen Worten verbirgt sich einer der spektakulärsten Wutanfälle, die von Goethe überliefert wurden. Sie galten einem neuen Judengesetz, das für das Großherzogtum Sachsen-Weimar und Eisenach erlassen wurde. Dieses trug dem Umstand Rechnung, dass sich mit der Erweiterung des Landesterritoriums durch den Wiener Kongress 1815 die Anzahl der jüdischen Bewohner von 40 auf 1386 erhöht hatte.
Es bedurfte nun einer landesweiten Regelung zum Rechtsstatus der Juden, zumal an vielen Orten in Deutschland mehr oder weniger zaghafte Schritte zu einer Emanzipation der Juden aus ihren benachteiligten Rechtsumständen längst unternommen worden waren. Aufgeklärte Diskussionen über die „Verbesserung“ der Juden – ihrer Lage, aber auch ihres daraus entspringenden Sozialcharakters – wurden auch in Deutschland seit einem halben Jahrhundert geführt. Die napoleonische Besetzung hatte dann einen starken Schub für die Gleichstellung von Juden gebracht. Die Reformen wurden allerdings nach 1815 vielerorts wieder zurückgedreht, unter anderem in Goethes Vaterstadt Frankfurt am Main.
Goethe hatte die in Frankfurt geführten Diskussionen aufmerksam verfolgt und sie in privaten Briefen sarkastisch kommentiert. Einen Befürworter der Emanzipation nannte er 1808 einen „Humanitätssalbader“, heute würde man „Gutmensch“ dazu sagen. Auch Bestrebungen, das Aufenthaltsrecht für Juden in der Universitätsstadt Jena zu liberalisieren, fanden nach dem Ende der Franzosenzeit nicht seinen Beifall. Judenfeindliche Traktate dieser Epoche las er mit Interesse, zuweilen mit Zustimmung.
Die Kette dieser emanzipationsfeindlichen Äußerungen fand ihren Höhepunkt in dem von Kanzler Müller ausführlich protokollierten Zornausbruch vom September 1823: „Ich war kaum gegen 6 Uhr in Goethes Zimmer getreten, als der alte Herr seinen leidenschaftlichen Zorn über unser neues Judengesetz, welches die Heirath zwischen beiden Glaubensverwandten gestattet, ausgoß. Er ahndete die schlimmsten und grellsten Folgen davon, behauptet, wenn der Generalsuperintendent Charakter habe, müsse er lieber seine Stelle niederlegen als eine Jüdin in der Kirche im Namen der heiligen Dreifaltigkeit trauen. Alle sittlichen Gefühle in den Familien, die doch durchaus auf den religiösen ruhten, würden durch ein solch scandalöses Gesetz untergraben; überdies wolle er nur sehen, wie man verhindern wolle, daß einmal eine Jüdin Oberhofmeisterin werde.“ Sogar Bestechung hielt Goethe bei dieser Gesetzgebung für möglich und nannte den Namen Rothschild. Was Goethe erregte, war also vor allem die Möglichkeit von jüdisch-christlichen Mischehen und damit dem ständischen Aufstieg für Juden.
Der amerikanische Germanist W. Daniel Wilson, als detektivischer und sehr kritischer Goethe-Forscher seit Jahrzehnten bekannt, hat nun alle Quellen zu Goethes Verhältnis zu den Juden seiner Zeit, darunter etliche Archivfunde, gesammelt und ausführlich in die Kontexte eingeordnet. Die wichtigsten von Goethes privaten Äußerungen waren auch bisher schon bekannt. Neu sind vor allem Wilsons Entdeckungen in der Verwaltungspraxis des Weimarer Herzogtums und der Blick auf die Judenfiguren am Weimarer Hoftheater unter Goethes Intendanz.
Auf beiden Feldern ist das Bild weit weniger düster, als es der Wutanfall von 1823 vermuten lassen könnte. 1785 hatte ein Weimarer Polizeibeamter namens Lindner durchreisende Juden – die ein eigenes Wegegeld entrichten mussten – schikaniert und übel beschimpft. Es kam zu einer Beschwerde der jüdischen Reisenden, die unter Goethes ausdrücklicher Zustimmung recht bekamen. „Am meisten fällt Lindners Betragen in die Augen, wenn man statt der Juden andre Kaufleute substituirt“, vermerkte Goethe. Er war im konkreten Fall also nicht bereit, eine Benachteiligung von Juden zu dulden.
Wilsons Untersuchungen sind äußerst detailliert und interessant über den Fall Goethes hinaus, denn sie zeigen den historischen Moment des Übergangs zur jüdischen Emanzipation in der neuen bürgerlichen, nachständischen Gesellschaft. Der Konflikt spielte sich auf allen gesellschaftlichen Ebenen ab, vom Polizeirecht bis zur Bühnenkunst. Goethes Freund Zelter etwa verglich schauspielerische Interpretationen der Figur des Shylock in Shakespeares „Kaufmann von Venedig“ und warb vehement für eine nicht karikaturistische, vielmehr tragische Darstellung: der Jude als verletzlicher Mensch.
Goethes immer nur privat geäußerte Ablehnung der rechtlichen Emanzipation steht nun in auffallendem Kontrast zu seinem positiven, produktiven Verhältnis zur jüdischen Überlieferung in seinen Werken. Ihm hat die amerikanische Germanistin Karin Schutjer eine bahnbrechende Darstellung gewidmet. Dabei ging es nicht nur um Goethes Bibellektüren samt ihren Einflüssen auf das Faust-Drama, sein Interesse an Spinoza und der Kabbala, sein Resümee der biblischen Vätergeschichten in „Dichtung und Wahrheit“, sondern auch um einen Plan für ein bayerisches Schulbuch aus dem Jahr 1808: Dort schlug Goethe für den Geschichtsunterricht die beispielhafte Behandlung von genau zwei Völkern vor: der Juden für die alte Geschichte und der Deutschen für die Zeit nach der Antike. Also Juden – oder Israeliten, das wurde damals nicht unterschieden – statt Griechen und Römern, wie es die humanistische Bildung später verlangte, sollten das antike Modellvolk sein.
Wilson behandelt ausdrücklich nicht diese literatur- und geistesgeschichtliche Seite von Goethes Verhältnis zum Judentum – es geht ihm um Goethes Beziehungen und Urteile zu konkreten jüdischen Menschen und ihren sozialen Verhältnissen. Waren Juden wohlhabend, gebildet oder gar konvertiert, pflegte Goethe höfliche und zuweilen freundschaftliche Beziehungen zu ihnen. Er vertraute auf ihre Dienste als Bankiers oder Kunsthändler, er war entzückt vom jungen Felix Mendelssohn, den er mit seinem Lehrer Zelter wochenlang zu Gast hatte.
Eine wichtige Schnittstelle der beiden Themen, des sozialgeschichtlichen und des geistesgeschichtlichen, ist Goethes Schilderung des Frankfurter Ghettos in „Dichtung und Wahrheit“. Sie ist einfühlsam, neugierig und voller Mitgefühl, und sie lässt sich durchaus als Illustration des zeitgenössischen Arguments lesen, dass die angeblichen negativen Züge des jüdischen Charakters – der sogenannten „Schacher- und Wucherjuden“ – von ihrer zurückgesetzten sozialen Lage herrühren und mit ihr verschwinden würden.
Den Zwiespalt, der sich hier zwischen Goethes öffentlicher Person als Beamter, Theatermann, Sammler, Bankkunde und Schriftsteller einerseits und seinen privaten Äußerungen andererseits auftut, überbrückt Wilson mit der Gedankenfigur der Imagepflege oder „Öffentlichkeitsarbeit“ (so sein Wort). Goethe habe darauf geachtet, nach außen als Judenfreund zu gelten, und seine judenfeindlichen Haltungen sorgfältig verborgen.
Immerhin wurden Korrespondenzpartner wie Bettina von Arnim, Sulpiz Boisserée und ein wichtiger Gesprächspartner wie Müller seine Zeugen. Auch hält Wilson zu Recht fest, dass Goethe nicht in rassischen Kategorien dachte, obwohl er eine Polygenesie der Menschheit, also die unabhängige Entstehung von Menschen an verschiedenen Orten der Erde für möglich hielt. Dass Goethe den aufkeimenden, sich „germanisch“ gebenden Nationalismus mit Abscheu beobachtete, hätte Wilson vielleicht etwas klarer hervorheben können. Antisemitismus aus „Germanomanie“ – so Saul Aschers scharfsinnige Diagnose – lag ihm ganz fern.
Aber was heißt bei einem publizierenden Autor „Öffentlichkeitsarbeit“? Goethe ist sein Werk, und so wollte er es. Mit ihm wirkte er und wollte er wirken. Nicht wirken wollte er mit seinen sporadisch geäußerten hässlichen Ressentiments. Als Beamter, als Theaterdirektor ist ihm wenig vorzuwerfen, im persönlichen Umgang auch nicht – sogar großzügige Unterstützung für einen verarmten Weimarer Juden hat er organisiert. Übrigens ist der Zwiespalt von werkgewordener gemäßigter Außenseite und oft drastischen Äußerungen im Privaten auch sonst bei Goethe zu beobachten. „Euphemismus“ nannte er das und begriff es als Stilideal.
All das relativiert nicht die gut dokumentierte Ablehnung konkreter Emanzipationsschritte in Frankfurt und Jena, vor allem aber der Weimarer Ermöglichung von Mischehen 1823. Was aber hat Goethe hier getriggert? Vermutlich die politisch organisierte Veränderung überkommener Lebensformen, also Politik, die über wohlwollendes Verwaltungshandeln im Bestehenden hinausging, um die Verhältnisse insgesamt neu zu ordnen. Politik als Bruch mit Traditionen, überhaupt: Politik, die mehr ist als „Regieren“. Die Juden als „Humanitätssalbader“ waren für Goethe Exponenten und Nutznießer dieser neuzeitlichen politischen Tendenz. Darin dürfte man den epochalen Kern seiner antijüdischen Gefühle fassen. Das allerdings sollte schon bald ein Hauptfaktor des modernen Antisemitismus werden: der Jude als Exponent der Moderne. Auch hier steht Goethe also untergründig im Kontakt mit den späteren Tendenzen seines Jahrhunderts, in diesem Fall seiner verheerendsten.
GUSTAV SEIBT
Antisemitismus aus
„Germanomanie“ lag
Goethe ganz fern
Ehen zwischen
Juden und Christen
lehnte Goethe ab
Mit gebildeten, wohlhabenden Juden pflegte Goethe gute, oft freundschaftliche Beziehungen.
Foto: IMAGO / GRANGER Historical Picture
W. Daniel Wilson: Goethe und die Juden. Faszination und Feindschaft. Verlag C. H. Beck, München 2024. 344 Seiten, 29,90 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
"Wilsons Untersuchungen sind äußerst detailliert und interessant über den Fall Goethes hinaus, denn sie zeigen den historischen Moment des Übergangs zur jüdischen Emanzipation in der neuen bürgerlichen, nachständischen Gesellschaft."
SZ, Gustav Seibt
"ein unkonventioneller Goethe-Forscher"
Deutschlandfunk Informationen und Musik, Michael Köhler
SZ, Gustav Seibt
"ein unkonventioneller Goethe-Forscher"
Deutschlandfunk Informationen und Musik, Michael Köhler

Daniel Wilson zeigt Goethes ambivalente Haltung gegenüber Juden.
Als Goethe zu seinem 72. Geburtstag im böhmischen Badeort Eger weilte, besuchte er mit seinem Freund Joseph Sebastian Grüner eine alte katholische Kirche und vertiefte sich dabei in hebräische Inschriften auf dem Opferstock. Nach einem Pogrom von 1350 hatte der böhmische König Sigismund die dort wieder zugezogenen Juden 1430 abermals vertreiben und die Synagoge in ein christliches Gotteshaus umwandeln lassen. Diese schreckliche Vorgeschichte erfuhren die Besucher 1821 in Eger, und Grüner beschließt sie in seinen 1853 erschienenen Gesprächsaufzeichnungen mit der Bemerkung: "Mir lag daran, Goethes Meinung über die Juden zu erfahren", doch der "äußerte sich nicht mit Bestimmtheit in Betreff der Juden". In den "Gesprächen" bei Biedermann 1889 ist die Pogromgeschichte noch enthalten, Wolfgang Herwig hat sie 1971 hingegen ohne Begründung gestrichen.
Was hier als Nebensache und editorische Petitesse erscheinen mag, wirkt im Kontext einer erdrückenden Zahl von Belegen zu "Goethes Meinung über die Juden" wie ein Symptom. Systematisch gesammelt und argumentativ verbunden hat sie jetzt der Germanist Daniel Wilson, der schon mit Büchern über Goethes Nähe zu den Illuminaten, dessen Votum für die Beibehaltung der Todesstrafe bei Kindsmord oder die Haltung des Dichters zur Absolutismuskritik in Weimar für Kontroversen sorgte. Wilson ist der Mann für heikle Themen, die er aber nie mit Skandallust, sondern mit den Mitteln der Philologie behandelt. Grüners Frage von 1821 beantwortet er im Untertitel seines Buches knapp mit: "Faszination und Feindschaft". Im Buch wird das anhand zahlreicher gedruckter und ungedruckter Dokumente, Brief- und Tagebuchpassagen, amtlicher Schriften sowie einer Reihe irritierender Stellen im dichterischen Werk zu der These geführt, dass judenfeindliche Äußerungen Goethes vor allem im Privaten erfolgten, die das öffentliche Bild des toleranten Humanisten möglichst nicht beschädigen sollten.
Wilsons Arbeit bewegt sich in drei Nachweis- und Deutungsfeldern: erstens eigene Erlebnisse und persönliche Beziehungen, zweitens politische und historische Urteile als Beamter und Jurist, drittens Darstellung jüdischer Figuren auf der Bühne und in der Literatur. Am Beginn steht natürlich die berühmte Passage über die Frankfurter Judengasse aus "Dichtung und Wahrheit", flankiert von Gesprächsaufzeichnungen. Zum einen ist da von Bewunderung für das "bibelschöpferische Volk", insbesondere das "Hohelied", sowie das ausdauernde Festhalten an "Gebräuchen" die Rede. Zum anderen spricht Goethe vom "unangenehmsten Eindruck", von Schmutz, Enge, Gewimmel, Zudringlichkeiten und "einer unerfreulichen Sprache". Für "Judendeutsch" hat der elfjährige Goethe gar einen Privatlehrer. Das neue Idiom mischt er in eine kurze "Judenpredigt", eine messianische Triumph-Phantasie gegen Vorbehalte der "Goyen". Sie liest sich wie eine parodierende Nachahmung, aus Frankfurter Mundart, jiddischen und hebräischen Wörtern gemischt. Im "Wilhelm Meister" kehren solche Aneignungen wieder: Serlos verschrobene "Karikatur eines jüdischen Rabinen" wird zwar als "Abgeschmacktheit" gekennzeichnet, gleichwohl kann sie "jeden geschmackvollen Menschen auf eine Viertelstunde glücklich machen".
Ambivalenzen wie hier bilden das Grundmuster fast aller Stellungnahmen Goethes. Als Anwalt in Frankfurt sind ein Viertel seiner Mandanten jüdisch, in Weimar unterhält er gute Geschäftsbeziehungen zu einigen Bankiers und Kunsthändlern. Zugleich muss er das hier erstmals abgedruckte Einwanderungsgesuch des Frankfurter Juden Michaelis Benedix, der sich "so ganz aus der Menschlichen gesellschafft abgewiesen" fühlt, im Mai 1793 ablehnen. Das geschieht in Wilsons zweitem Untersuchungsgebiet: in der Funktion als Geheimer Rat. Bei Einführung einer neuen Judenordnung 1823, als im Herzogtum Weimar auch die jüdische Bevölkerung nach dem Wiener Kongress stark anwuchs, sprach sich Goethe vehement gegen Mischehen aus. Und als Verantwortlicher für das sogenannte Geleitwesen in allen thüringischen Fürstentümern und dem zu Kurmainz gehörenden Erfurt musste er qua Amt auf Leibzollgebühren für Juden und ihre Güter auf dem Transit zur Leipziger Messe bestehen. Umgekehrt gibt er 1785 einigen jüdischen Reisenden recht, die sich wegen des Wegegeldes von einem Polizisten schikaniert und beschimpft sahen.
Das Kindheitsbild vom Ghetto in Frankfurt, der "judenfeindlichsten Stadt Deutschlands", so der selbst aus der Judengasse stammende Ludwig Börne, tritt dabei immer wieder in den Blick. Von dem unvergesslichen "Spott- und Schandgemälde" unter dem Brückenturm, das Goethe als Knabe mit Abscheu sieht und auch in einem Buch aus der väterlichen Bibliothek abgebildet finden konnte, bis zur Gleichstellung der Juden 1811 ist es ein weiter Weg. Bei der französischen Bombardierung Frankfurts im Juli 1796 wird die Judengasse schwer zerstört, erstmals dürfen die obdachlosen Menschen auch in anderen Teilen der Stadt siedeln. Tatsächlich befördert Frankreich die Emanzipationsbestrebungen der Juden, artikuliert etwa in dem Plädoyer für eine "neue Stättigkeits- und Schutzordnung" von Israel Jakobsohn von 1808. Schmähschriften dagegen sah Goethe gern, nennt Jacobsohn gegenüber Bettina Brentano einen "Humanitätssalbader" und rückt ihn durch Verdrehung seines Namens als "Jacobinischen Israels Sohn" in die Nähe der verhassten Französischen Revolution.
Emanzipation setzt für Goethe durchgängig Assimilation oder Akkulturation, wenn nicht Konversion voraus. Den rassistischen Theorien des Göttinger Philosophieprofessors Christoph Meiners ("Über die Verschiedenheiten der Menschennaturen") hat er sich aber nie angeschlossen, nur den harmloseren ersten Band von Meiners ließ er in seiner Bibliothek überhaupt aufschneiden.
Im dritten Untersuchungsfeld, der Dichtung, zeigt sich eine größere Zurückhaltung Goethes, die Wilson immer wieder im Vergleich der Fassungen nachweisen kann. Zudem gibt eine Figurenrede oder die Wiedergabe zeitgenössischer Stereotype nicht unbedingt Goethes eigene Meinung wieder. Sie finden sich an etlichen beiläufigen Stellen, auch im "Faust", etwa wenn die Vereinnahmung von "ungerechtem Gut" - hier Geschenke an Gretchen - durch die Kirche kritisiert wird. Faust wendet dagegen ein: "Ein Jud' und König kann es auch." In einem Purimspiel im "Jahrmarkts-Fest zu Plundersweilern", einem Theater im Theater, sind judenfeindliche Klischees häufiger. Sie verdanken sich einzelnen Rollen, Goethe spielte 1778 bei der Uraufführung sogar selbst den Marktschreier, den Judenfeind Haman und den Juden Mardochai.
Als Theaterdirektor nimmt Goethe ausgesprochen judenfeindliche Stücke nicht ins Programm, lässt weit verbreitete negative, karikierende Darstellungen jüdischer Rollen aber zu. Als Iffland bei seinem Gastspiel in Weimar 1813 als Shylock im "Kaufmann von Venedig" auftrat, beschwert sich Zelter, dass sein Spiel diesen "Venetianischen Juden nun zu einem knotigen lausigen Wasserpolakken erniedrigt" habe. Goethe nahm an solchen Spottdarstellungen keinen Anstoß, umgekehrt brachte er 1798 Richard Cumberlands "Der Jude" und 1811 Ludwig Roberts Trauerspiel "Die Tochter Jephta's" zur Aufführung, das erste Originalstück eines jüdischen Autors auf einer deutschen Bühne. Man sieht: Ambivalenzen und Widersprüche, wohin man blickt. Goethe steht damit alles andere als allein. Auf viele seiner Zeitgenossen trifft Börnes Bemerkung zu, dass die Deutschen in "Judensachen einen Sparren im Kopf" haben. Der Amerikaner Wilson, der in Berkeley und London lehrte, wirft Goethe deshalb nichts vor. Vielmehr rechnet er das zu den zentralen Problemen der deutschen Geschichte, die es zu verstehen gilt. ALEXANDER KOSENINA
W. Daniel Wilson: "Goethe und die Juden". Faszination und Feindschaft.
Verlag C. H. Beck, München 2024. 351 S., Abb., geb.,
29,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main