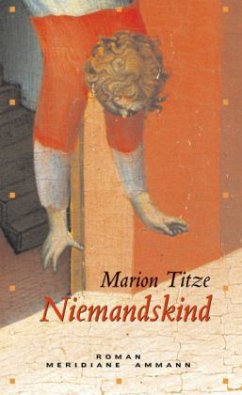Was tun, wenn das eigene Kind durchdreht? Eine Mutter erzählt: "Es ist als bräche ein Damm. Das Denken wird fortgespült von den Furien des Empfindens, und dein Leben starrt dich an wie ein Feind." Bei der Scheidung war Jan vierzehn und ist dann bei seinem Vater aufgewachsen. Nach einem mißlungenen LSD-Experiment kriegt er nichts mehr auf die Reihe. Er läßt sein Studium schleifen, hängt mit dubiosen Freunden rum und wird von abgründigen Ängsten gebeutelt. Wie die Eltern mit der eigenen Hilflosigkeit umgehen, angesichts dieses Kinds, dem - trotz allem aufgebotenen sächsischen Pragmatismus ("wahrscheinlich sind Psychosen das kommende Outfit") - nicht zu helfen ist, das beschreibt Marion Titze wunderbar authentisch und mit nachfühlbarer Genauigkeit.

„Niemandskind”: Marion Titze hat einem schwierigen Thema die richtige Form gegeben
Panik, Hilflosigkeit, nackte Angst: Nur wenig löst ein vergleichbares Gefühl existenzieller Bedrohung aus wie die Sorge um Leib und Leben des eigenen Kindes. Ob es sich um eine Krankheit, einen Unfall oder, wie im Fall von Marion Titzes „Niemandskind”, um die Folgen eines Drogenexperiments handelt, immer leiden die Eltern zweifach, mit dem Kind und an sich selbst. Haben sie etwas falsch gemacht? Hätten sie das Kind vor seinem Schicksal bewahren können? Gibt es das überhaupt, Schicksal, oder hat der Zufall blindwütig ausgerechnet bei ihnen zugeschlagen? Das Leben befindet sich im Ausnahmezustand, alle Alarmglocken schrillen, doch der Notausgang ist versperrt. Es gibt keinen Ausweg, höchstens Linderung durch Gewöhnung - und manchmal die Hoffnung auf ein Wunder.
Auf den Hund gekommen
Marion Titze erzählt mit bemerkenswerter Nüchternheit die Geschichte von Jan. Man kennt diesen Typus, man findet ihn überall, in Großstädten und in der Provinz, an Bahnhöfen und Kiosken, in Abbruchhäusern und Landkommunen: junge Männer, denen man, so heruntergekommen sie sein mögen, immer noch die Sensibilität ansieht, das weiche Gesicht, das sie als Knaben hatten, schüchterne, ziellos nach Zuneigung suchende Augen. Und fast immer haben diese Männer einen Hund bei sich, den sie besser behandeln als sich selbst. So ist das auch mit Jan. Als er sich fast schon wieder aufgerappelt hat und die durch einen LSD-Trip ausgelösten psychotischen Störungen einigermaßen in den Griff zu bekommen scheint, bricht ihm der Tod eines Hundes das Genick. Dabei ist es nicht einmal sein eigener, sondern der Hund eines Freundes, den er, zu dessen Schutz, ins Tierheim bringen lassen wollte. Doch ein Polizist drückt ab: „Sie hatten genug von verwahrlosten Typen mit einem durchgeknallten Kampfhund.”
Elterliche Panik ist selten erzählbar. Bücher wie Laure Adlers „Bis heute abend” und P.F. Thoméses „Schattenkind”, die vom Tod des eigenen Kindes handeln, sind eher atemlose Prosaprotokolle als Romane im engeren Sinn. „Niemandskind” aber ist ein solcher, weil die Autorin für ihren bedrängenden Stoff eine erzählerische Form gefunden hat. Eine klug konstruierte Rahmenhandlung hält den Roman im Gleichgewicht und erlaubt eine Vervielfältigung der Perspektive: die Innenansicht der Mutter, die des Sohnes und der Blick auf ihn von außen wechseln sich ab und ergänzen einander.
Marion Titze erfindet einen jungen Mann, dem Annemarie, die Erzählerin, alles offenbart, was sie im Lauf ihrer Familienrecherche zusammengetragen hat. Er heißt Martin, ist Philosophiestudent und der Sohn von Annemaries Cousin Thomas, der sich umgebracht hat. Im Nachlass des Vaters fand er Briefe von ihr und hofft nun, in den paar Stunden, in denen er sich auf der Durchreise in Berlin befindet, mehr über den Verstorbenen zu erfahren, der noch während der DDR-Zeit wegen einer Psychose in der Nervenheilanstalt war. Aus den Bruchstücken eines intensiven Gesprächs entsteht so das Mosaik einer Familiengeschichte. Und die ist zugleich eine Geschichte des geteilten und wiedervereinigten Deutschland.
Die Kunst der Autorin aber besteht darin, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Ohne simple Schuldzuweisungen werden doch einzelne Auslösefaktoren sichtbar: Die Stasi-Anwerbung hat offenbar dazu beigetragen, die Psyche des Cousins zu zerschlagen. Die leichte Zugänglichkeit von Drogen im wiedervereinigten Berlin ist dem Sohn Jan zum Verhängnis geworden, aber auch das Auseinanderbrechen seiner Familie. Jan war vierzehn, als sich die Eltern scheiden ließen. Er blieb beim Vater, der jüngere Bruder bei der Mutter. So hat Jan die Lektion seines Vaters, dass man die Liebe einer Frau nicht erzwingen könne, auch auf sich bezogen. Was als Liebesbeweis gedacht war, der mütterliche Verzicht auf den älteren Sohn zugunsten seiner ausgeprägten Vater-Beziehung, verkehrt sich in sein Gegenteil. Der Sohn fühlt sich verlassen. Das ist nicht mehr zu reparieren, auch nicht, als ihn die Mutter, nachdem sie das Ausmaß seiner Verstörung erkannt hat, eine Zeit lang zu sich holt.
Mein eigener Anwalt
Alles, was sie anstellt, ist falsch. Während sie für den erwachsenen Sohn ein Nestchen baut, befindet er sich schon wieder auf der Flucht und kommt erst Tage später wieder. Die Mutter beherrscht sich, markiert Wohlverhalten, stellt ihn nicht zur Rede. Kurze Zeit geht es gut, bis zur nächsten Krise. Nicht nur den Leser packt das Mitleid, auch sie selbst: „Ich kam mir jammervoll vor in meinem Eifer.” Manchmal gibt es Momente der Selbstbehauptung. Nein, das habe sie nicht verdient, sagt sie sich dann und Sätze wie „Undank ist der Welt Lohn”. Aber natürlich weiß sie, dass das die Schlimmste aller Elternfallen ist: „Ich sah mich geprellt und wechselte einen gefährlichen Moment die Seiten, ich war nicht mehr die Schutzmacht meines Kindes, sondern mein eigener Anwalt.”
Einzig mit ihrer Vorstellungsgabe kommt sie dem Sohn noch nah. Die Szenen, in denen sie sich in ihn hineinimaginiert, in das heillose Verschwimmen der Gegenstände während des Drogen-Trips, in das Fahrigwerden, die Unkonzentriertheit, die Koordinationsstörungen, die ständige panische Angst, diese Szenen sind Salto-mortale-Kunststücke mütterlicher Empathie. Wenn sie sich vorstellt, wie der völlig aus der Bahn Geworfene, der zunächst wieder beim Vater einzog, in seinem alten Kinderzimmer hockte, allein wie immer, dann findet sie starke Bilder. Die Sterne werden zu Suchscheinwerfern: „Da, holt ihn euch, dem kommt keiner helfen.”
Am Ende bringt die Erzählerin ihren Zuhörer zum Bahnhof. Das Schicksal Jans ist offen geblieben. Ein kleiner Abschiedsdialog entspinnt sich: „,Ja, sagte ich, ,die Philosophen haben uns allerhand eingeredet. Zum Beispiel, dass einen stärker macht, was einen nicht umbringt. Aber es stimmt nicht, es ist nicht wahr”. Im Inneren aber denkt sie: „Vielleicht ist es wahr. Es hat nur keine Lust, sich an dir zu bewahrheiten. Es sucht sich andere, die es stärken will, dich lässt es umfallen. Denn ein paar müssen fallen.” Die Autorin allerdings hat dieses Buch, das ihr bisher bestes ist, gestärkt. Sie hat den „unbekannten Verlust”, wie ihr Romandebüt nach Freuds Definition der Melancholie betitelt war, ins Kenntliche getrieben und am konkreten Stoff ihr literarisches Können eindrucksvoll bewiesen. Denn nichts ist so schwer, wie einem Betroffenheitsthema die richtige Form zu geben.
MEIKE FESSMANN
MARION TITZE: Niemandskind. Roman. Ammann Verlag, Zürich 2004. 187 Seiten, 18,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
""Nichts ist so schwer, wie einem Betroffenheitsthema die richtige Form zu geben", schreibt Meike Fessmann, um zu bestärken, wie gut ihr dieser Roman von Marion Titze gefallen hat. Das Thema ist die mütterliche Angst um das Kind, die Panik, wenn sein Leben sich dem helfenden, dem hilflosen Zugriff entwindet. Der Sohn Jan ist ein Scheidungskind, das beim Vater blieb, der sich dann allerdings umbringt. Als er zur Mutter zurückkehrt, flieht er in Drogenexperimente und landet schließlich auf der Straße. Die Qualitäten von Titzes Roman liegen nach Ansicht der Rezensentin in der Nüchternheit der Erzählung, im geschickten Wechsel aus der Innensicht Jans und der um Nähe ringenden Außensicht der Mutter - "Salto-mortale-Kunststücke mütterlicher Empathie", schreibt Fessmann. Nichts wird mit schlichter psychologischer Logik erklärt, und doch zeichnen sich Ursachen ab. Titze hat, so die Rezensentin, "am konkreten Stoff ihr literarisches Können eindrucksvoll bewiesen".
©
©