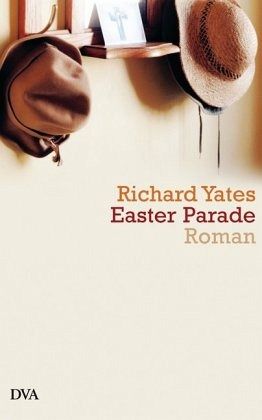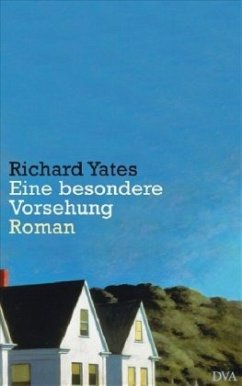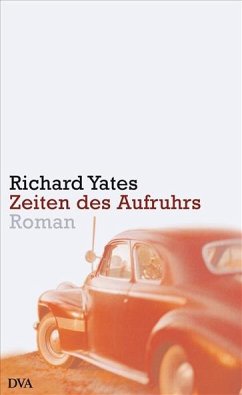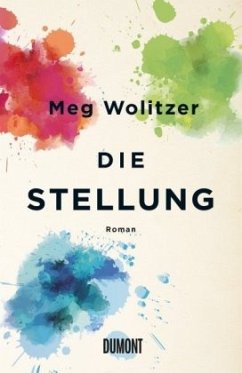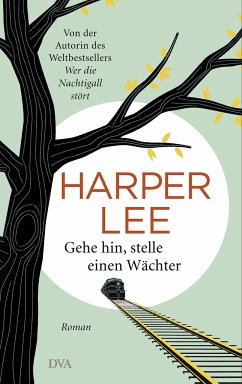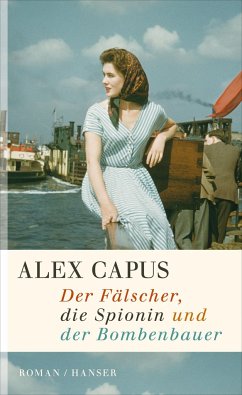Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





40 Jahre Einsamkeit - die Geschichte zweier Schwestern, die darum kämpfen, der Vergangenheit zu entkommen. Richard Yates ist ein Meister der klaren Worte. Er erzählt nüchtern, geradezu lakonisch und zeichnet seine Figuren mit tiefer Sympathie.
Die Schwestern Sarah und Emily Grimes wachsen als Kinder geschiedener Eltern in den USA der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts auf. Beide haben unter den Launen ihrer rastlosen Mutter zu leiden, die nach jeder beruflichen oder privaten Enttäuschung mit den Mädchen in eine andere Stadt zieht. Über die Jahre hätten sich die Schwestern nicht unterschiedlicher entwickeln können: Sarah heiratet früh, bekommt drei Söhne und lebt auf Long Island. Emily macht Karriere in New York und stürzt sich von einer Affäre in die nächste. Endlich scheinen beide das Leben leben zu können, das sie sich immer gewünscht haben. Doch Sarahs Ehe ist nicht so glücklich wie alle glauben. Und erst als sie ihre Stelle verliert, wird Emily bewusst, wie einsam sie in Wirklichkeit ist.
"Nur wenige Männer seit Flaubert haben Frauen, deren Leben die Hölle ist, ein solches Mitgefühl entgegengebracht." Kurt Vonnegut
"Yates schreibt packend und fühlt sich mühelos in das Leben seiner Charaktere ein. Eine aufrüttelnde Geschichte." The New York Times
"Ein Meisterwerk. Ein entschlossener Roman von seltener Kraft." Mordecai Richlertiefer Sympathie.
"Nur wenige Männer seit Flaubert haben Frauen, deren Leben die Hölle ist, ein solches Mitgefühl entgegengebracht." Kurt Vonnegut
"Yates schreibt packend und fühlt sich mühelos in das Leben seiner Charaktere ein. Eine aufrüttelnde Geschichte." The New York Times
"Ein Meisterwerk. Ein entschlossener Roman von seltener Kraft." Mordecai Richlertiefer Sympathie.
Yates, Richard
Richard Yates wurde 1926 in Yonkers, New York, geboren und lebte bis zu seinem Tod 1992 in Alabama. Obwohl seine Werke zu Lebzeiten kaum Beachtung fanden, gehören sie heute zum Wichtigsten, was die amerikanische Literatur des 20. Jahrhunderts zu bieten hat. Wie Ernest Hemingway prägte Richard Yates eine Generation von Schriftstellern. Die DVA publiziert Yates' Gesamtwerk auf Deutsch, zuletzt erschien der Roman "Eine strahlende Zukunft". Das Debüt "Zeiten des Aufruhrs" wurde 2009 mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen von Regisseur Sam Mendes verfilmt. "Cold Spring Harbor", zuerst veröffentlicht 1986, ist Yates' letzter vollendeter Roman.
Richard Yates wurde 1926 in Yonkers, New York, geboren und lebte bis zu seinem Tod 1992 in Alabama. Obwohl seine Werke zu Lebzeiten kaum Beachtung fanden, gehören sie heute zum Wichtigsten, was die amerikanische Literatur des 20. Jahrhunderts zu bieten hat. Wie Ernest Hemingway prägte Richard Yates eine Generation von Schriftstellern. Die DVA publiziert Yates' Gesamtwerk auf Deutsch, zuletzt erschien der Roman "Eine strahlende Zukunft". Das Debüt "Zeiten des Aufruhrs" wurde 2009 mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen von Regisseur Sam Mendes verfilmt. "Cold Spring Harbor", zuerst veröffentlicht 1986, ist Yates' letzter vollendeter Roman.
Produktdetails
- Verlag: DVA
- Originaltitel: The Easter Parade
- Seitenzahl: 296
- Erscheinungstermin: Februar 2007
- Deutsch
- Abmessung: 205mm
- Gewicht: 426g
- ISBN-13: 9783421042613
- ISBN-10: 3421042616
- Artikelnr.: 20945075
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.03.2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.03.2007Mit Flair in den Abgrund
Klassiker auf dem Vormarsch: Richard Yates fasst mit "Easter Parade" endlich Fuß in Deutschland / Von Heinrich Wefing
Als der Schriftsteller Richard Yates 1992 in einem winzigen Apartment in Birmingham, Alabama, starb, von einer Lungenkrankheit gezeichnet, vom Alkohol ruiniert, da war sein Werk selbst in Amerika weithin vergessen. Vermutlich wäre es für immer in den Archiven der Literaturgeschichte vermodert, hätten sich nicht einige jüngere Autoren nachdrücklich für ihn eingesetzt. Zumal Stewart O'Nan warb 1999 in einem langen Essay in der "Boston Review" dafür, in Bibliotheken und Antiquariaten nach den vergriffenen Büchern von Yates zu stöbern und sie von Hand zu Hand zu reichen wie
Klassiker auf dem Vormarsch: Richard Yates fasst mit "Easter Parade" endlich Fuß in Deutschland / Von Heinrich Wefing
Als der Schriftsteller Richard Yates 1992 in einem winzigen Apartment in Birmingham, Alabama, starb, von einer Lungenkrankheit gezeichnet, vom Alkohol ruiniert, da war sein Werk selbst in Amerika weithin vergessen. Vermutlich wäre es für immer in den Archiven der Literaturgeschichte vermodert, hätten sich nicht einige jüngere Autoren nachdrücklich für ihn eingesetzt. Zumal Stewart O'Nan warb 1999 in einem langen Essay in der "Boston Review" dafür, in Bibliotheken und Antiquariaten nach den vergriffenen Büchern von Yates zu stöbern und sie von Hand zu Hand zu reichen wie
Mehr anzeigen
einen Schatz, bis endlich ein Verlag begreifen möge, dass hier ein amerikanischer Klassiker des zwanzigsten Jahrhunderts wiederzuentdecken sei.
In Deutschland hatte das Werben Erfolg. Vor fünf Jahren veröffentlichte die DVA "Zeiten des Aufruhrs", den 1961 unter dem Titel "Revolutionary Road" herausgekommenen Erstling von Yates. 2006 folgte ein grandioser Band mit Kurzgeschichten, "Elf Arten der Einsamkeit" (F.A.Z. vom 15. März 2006), und nun erscheint, dreißig Jahre nach der Erstpublikation, zum ersten Mal in deutscher Übersetzung der Roman "Easter Parade". Es ist, man darf es ruhig so pathetisch formulieren, ein Ereignis. Nichts hat das Buch von seiner Frische, von seiner bewegenden Kraft verloren. Man liest es mit stockendem Atem und wundem Herzen.
Yates ist der melancholische Chronist der amerikanischen Mittelklasse in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Mit geradezu selbstquälerischer Genauigkeit hat er die Leute in den Vorstädten und Büroetagen beobachtet, ihre Sorgen notiert, ihre bescheidenen Träume verzeichnet und voller Anteilnahme beschrieben, wie das ohnehin triste Leben mit den Jahren immer enger wird, wie selbst die kleinen Hoffnungen nach und nach zerbröseln, bis nichts mehr an ihrer Stelle bleibt als eine schmerzende, pochende Leere, die schwerer zu ertragen ist als der Verlust der Träume selbst.
Sarah und Emily wachsen in den dreißiger und vierziger Jahren, gegen Ende der Großen Depression, unweit von New York bei ihrer unsteten, egozentrischen Mutter auf, deren einziger Ehrgeiz darin besteht, "die schwer fassbare Eigenschaft, die sie ,Flair' nannte, zu erlangen und beizubehalten. Sie brütete über Modezeitschriften, kleidete sich geschmackvoll und versuchte ihr Haar auf verschiedene Weise zu frisieren, aber ihre Augen blickten immer verwirrt, und sie lernte nie, den Lippenstift innerhalb der Grenzen ihres Mundes aufzutragen." Unablässig ziehen Mutter und Töchter von Vorort zu Vorort, immer in die feineren Viertel, die sie sich nicht leisten können, und schließlich nach Manhattan, in eine schäbige, einstmals herrschaftliche Wohnung am Washington Square.
Sarah, ohne Ehrgeiz, naiv wie ihre Mutter, gesegnet nur mit einer guten Figur, heiratet früh einen jungen Mann aus der Nachbarschaft, dessen größte Vorzüge ein elitär klingender Akzent und ein Grundstück auf Long Island sind, das Sarah und ihre Mutter hartnäckig ein "Anwesen" nennen, obwohl darauf nur ein altes, düsteres, schwer zu heizendes Haus steht. In drei Jahren bringt Sarah dort drei Jungen zur Welt, versinkt im Strudel der Mutterschaft und unter den Schlägen ihres Mannes, dessen Upper class-Manieren sich rasch als furchtbarer Irrtum erweisen.
Emily scheint es anfangs besser zu treffen. Sie erhält ein Stipendium für ein angesehenes College, macht Karriere, legt sich eine beeindruckende Reihe von Liebhabern zu, erlebt wohl auch manche Augenblicke, die sich wie Glück anfühlen, im Beruf, auf Reisen, im Bett; aber keiner dieser Momente ist von Dauer. Während in fein hingetupften Details das amerikanische Jahrhundert vorbeizieht - der Zweite Weltkrieg, Kennedy, Vietnam, die Zersiedelung von Long Island -, die Yates immer wieder in Nebensätzen schildert, entfernt sich Emily zusehends von ihrer Mutter und ihrer Schwester, irritiert zuerst, dann angewidert von deren Naivität und ihren vulgären kleinen Vergnügungen. Doch hinter der Fassade des working girl bleibt stets eine bohrende Furcht vor dem Alleinsein, die Emily in die Arme immer neuer Männer treibt, bis schließlich ihre Jugend verblüht ist, ihr Bett leer bleibt und nur der Alkohol trügerischen Trost spendet.
Richard Yates erzählt in kraftvollen, bezwingend schlichten Sätzen, in denen es kein Wort zuviel gibt, keine prätentiöse Spielerei, und es ist ein schönes Glück, dass Anette Grube diese durchsichtige Sprache so zwanglos ins Deutsche übertragen hat. Nüchtern, fast wie ein Arzt protokolliert Yates die Lebensläufe der beiden Schwestern und schildert mit tiefer Sympathie zwei überforderte, existentiell verwirrte Menschen, zwei Menschen in der modernen Masse, denen ein Leben entgleitet.
Unverkennbar sind autobiographische Züge. Die frühe Scheidung der Eltern, ständige Umzüge mit der überforderten Mutter, die Qualen des Angestelltendaseins in der Werbeindustrie, die zermürbende Eifersucht auf den Erfolg der Kollegen, Alkoholexzesse, zerbrechende Lieben - all das hat Richard Yates selbst erlebt. In der Figur von Sarahs und Emilys Vater Walter, einem sensiblen, lungenkranken, mäßig talentierten Journalisten bei einer lausigen Zeitung, den die Mädchen gleichwohl zärtlich lieben, bewundern und ein Leben lang vermissen, hat Yates ein berührendes Selbstporträt eines scheiternden Mannes gezeichnet, eines Mannes, der sich jeden Moment schmerzhaft bewusst ist, dass er ein Verlierer ist, und den doch jede Niederlage neuerlich verletzt.
Die Angst abzustürzen, das Wenige zu verlieren, wofür man sich so lange gequält hat - den Job, das Häuschen in der Vorstadt, den Respekt der Nachbarn, den Respekt vor sich selbst -, diese Angst grundiert alle Geschichten von Yates. Es ist eine Angst, die in Amerika präsenter ist als in Deutschland mit seinen sozialen Netzen und Sicherungen, die aber auch hierzulande an der Mittelschicht zu nagen beginnt. Insofern ist "Easter Parade" ein geradezu unheimlich aktuelles Buch - und ein berückend schönes, tief trauriges dazu, das nun endlich, endlich die Leser finden sollte, die es verdient.
Richard Yates: "Easter Parade." Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Anette Grube. DVA, München 2007. 304 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
In Deutschland hatte das Werben Erfolg. Vor fünf Jahren veröffentlichte die DVA "Zeiten des Aufruhrs", den 1961 unter dem Titel "Revolutionary Road" herausgekommenen Erstling von Yates. 2006 folgte ein grandioser Band mit Kurzgeschichten, "Elf Arten der Einsamkeit" (F.A.Z. vom 15. März 2006), und nun erscheint, dreißig Jahre nach der Erstpublikation, zum ersten Mal in deutscher Übersetzung der Roman "Easter Parade". Es ist, man darf es ruhig so pathetisch formulieren, ein Ereignis. Nichts hat das Buch von seiner Frische, von seiner bewegenden Kraft verloren. Man liest es mit stockendem Atem und wundem Herzen.
Yates ist der melancholische Chronist der amerikanischen Mittelklasse in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Mit geradezu selbstquälerischer Genauigkeit hat er die Leute in den Vorstädten und Büroetagen beobachtet, ihre Sorgen notiert, ihre bescheidenen Träume verzeichnet und voller Anteilnahme beschrieben, wie das ohnehin triste Leben mit den Jahren immer enger wird, wie selbst die kleinen Hoffnungen nach und nach zerbröseln, bis nichts mehr an ihrer Stelle bleibt als eine schmerzende, pochende Leere, die schwerer zu ertragen ist als der Verlust der Träume selbst.
Sarah und Emily wachsen in den dreißiger und vierziger Jahren, gegen Ende der Großen Depression, unweit von New York bei ihrer unsteten, egozentrischen Mutter auf, deren einziger Ehrgeiz darin besteht, "die schwer fassbare Eigenschaft, die sie ,Flair' nannte, zu erlangen und beizubehalten. Sie brütete über Modezeitschriften, kleidete sich geschmackvoll und versuchte ihr Haar auf verschiedene Weise zu frisieren, aber ihre Augen blickten immer verwirrt, und sie lernte nie, den Lippenstift innerhalb der Grenzen ihres Mundes aufzutragen." Unablässig ziehen Mutter und Töchter von Vorort zu Vorort, immer in die feineren Viertel, die sie sich nicht leisten können, und schließlich nach Manhattan, in eine schäbige, einstmals herrschaftliche Wohnung am Washington Square.
Sarah, ohne Ehrgeiz, naiv wie ihre Mutter, gesegnet nur mit einer guten Figur, heiratet früh einen jungen Mann aus der Nachbarschaft, dessen größte Vorzüge ein elitär klingender Akzent und ein Grundstück auf Long Island sind, das Sarah und ihre Mutter hartnäckig ein "Anwesen" nennen, obwohl darauf nur ein altes, düsteres, schwer zu heizendes Haus steht. In drei Jahren bringt Sarah dort drei Jungen zur Welt, versinkt im Strudel der Mutterschaft und unter den Schlägen ihres Mannes, dessen Upper class-Manieren sich rasch als furchtbarer Irrtum erweisen.
Emily scheint es anfangs besser zu treffen. Sie erhält ein Stipendium für ein angesehenes College, macht Karriere, legt sich eine beeindruckende Reihe von Liebhabern zu, erlebt wohl auch manche Augenblicke, die sich wie Glück anfühlen, im Beruf, auf Reisen, im Bett; aber keiner dieser Momente ist von Dauer. Während in fein hingetupften Details das amerikanische Jahrhundert vorbeizieht - der Zweite Weltkrieg, Kennedy, Vietnam, die Zersiedelung von Long Island -, die Yates immer wieder in Nebensätzen schildert, entfernt sich Emily zusehends von ihrer Mutter und ihrer Schwester, irritiert zuerst, dann angewidert von deren Naivität und ihren vulgären kleinen Vergnügungen. Doch hinter der Fassade des working girl bleibt stets eine bohrende Furcht vor dem Alleinsein, die Emily in die Arme immer neuer Männer treibt, bis schließlich ihre Jugend verblüht ist, ihr Bett leer bleibt und nur der Alkohol trügerischen Trost spendet.
Richard Yates erzählt in kraftvollen, bezwingend schlichten Sätzen, in denen es kein Wort zuviel gibt, keine prätentiöse Spielerei, und es ist ein schönes Glück, dass Anette Grube diese durchsichtige Sprache so zwanglos ins Deutsche übertragen hat. Nüchtern, fast wie ein Arzt protokolliert Yates die Lebensläufe der beiden Schwestern und schildert mit tiefer Sympathie zwei überforderte, existentiell verwirrte Menschen, zwei Menschen in der modernen Masse, denen ein Leben entgleitet.
Unverkennbar sind autobiographische Züge. Die frühe Scheidung der Eltern, ständige Umzüge mit der überforderten Mutter, die Qualen des Angestelltendaseins in der Werbeindustrie, die zermürbende Eifersucht auf den Erfolg der Kollegen, Alkoholexzesse, zerbrechende Lieben - all das hat Richard Yates selbst erlebt. In der Figur von Sarahs und Emilys Vater Walter, einem sensiblen, lungenkranken, mäßig talentierten Journalisten bei einer lausigen Zeitung, den die Mädchen gleichwohl zärtlich lieben, bewundern und ein Leben lang vermissen, hat Yates ein berührendes Selbstporträt eines scheiternden Mannes gezeichnet, eines Mannes, der sich jeden Moment schmerzhaft bewusst ist, dass er ein Verlierer ist, und den doch jede Niederlage neuerlich verletzt.
Die Angst abzustürzen, das Wenige zu verlieren, wofür man sich so lange gequält hat - den Job, das Häuschen in der Vorstadt, den Respekt der Nachbarn, den Respekt vor sich selbst -, diese Angst grundiert alle Geschichten von Yates. Es ist eine Angst, die in Amerika präsenter ist als in Deutschland mit seinen sozialen Netzen und Sicherungen, die aber auch hierzulande an der Mittelschicht zu nagen beginnt. Insofern ist "Easter Parade" ein geradezu unheimlich aktuelles Buch - und ein berückend schönes, tief trauriges dazu, das nun endlich, endlich die Leser finden sollte, die es verdient.
Richard Yates: "Easter Parade." Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Anette Grube. DVA, München 2007. 304 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Ursula März stellt den jetzt auf Deutsch erschienenen zweiten Roman des bereits verstorbenen amerikanischen Autors Richard Yates vor und lässt wissen, dass der amerikanische Autor erst vor wenigen Jahren wieder als "Klassiker" entdeckt wurde. Im autobiografisch gefärbten Roman um die zwei Schwestern Emily und Sarah, deren Versuche, sich von der alkoholkranken Mutter abzusetzen, beide auf ihre Art scheitern, wird exzessiv getrunken, was Emily einen frühen Tod mit 47 beschert, teilt die Rezensentin mit. Hoffnungslosigkeit und Resignation durchziehe als charakteristisches Merkmal das Buch, das von fortwährendem "Selbstbetrug" und Selbstzerstörung mittels Alkohol erzähle. Wenn der Roman nach März auch nicht an "Zeiten des Aufruhrs" heranreicht, den erste Roman Yates, der Furore machte, so scheint die Rezensentin dennoch von dem Buch recht beeindruckt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ein geradezu unheimlich aktuelles Buch - und ein berückend schönes, tief trauriges dazu, das nun endlich, endlich die Leser finden sollte, die es verdient." Frankfurter Allgemeine Zeitung
„Keine der Grimes-Schwestern sollte im Leben glücklich werden“ - so beginnt Richard Yates‘ Roman „Easter Parade“. Der 1976 erschienene Roman vereint zwei Frauenbiografien. Yates verfolgt die Lebenswege der beiden unterschiedlichen Schwestern Sarah und Emily …
Mehr
„Keine der Grimes-Schwestern sollte im Leben glücklich werden“ - so beginnt Richard Yates‘ Roman „Easter Parade“. Der 1976 erschienene Roman vereint zwei Frauenbiografien. Yates verfolgt die Lebenswege der beiden unterschiedlichen Schwestern Sarah und Emily über vier Jahrzehnte.
Der Roman beginnt in den 1930er Jahren. Sarah und Emily, die Grimes-Schwestern, leiden als Kinder unter der Scheidung ihrer Eltern und ihrer extravaganten Mutter Esther. Die zieht mit ihren Töchtern von Ort zu Ort, immer auf der Suche nach beruflichem Erfolg und einem neuen Mann. Esther träumt davon, zu den Privilegierten zu gehören, doch ihre Träume landen im Alkohol. Immerhin will sie ihren Töchtern dieses Schicksal ersparen.
Die ältere und attraktivere Tochter Sarah scheint auch einen guten Start zu haben, sie lernt den gutaussehenden, aber mittellosen Engländer Tony kennen. Das Paar wohnt auf dem Landsitz seiner Eltern und aus der Ehe gehen bald drei Söhne hervor. Doch irgendwann nimmt Sarah die Trinkgewohnheiten ihrer Mutter an und ihr Traumprinz Tony entpuppt sich als prügelnder Ehemann. Der Alkohol und der häusliche Streit treiben Sarah schließlich in den Tod.
Emily, die jüngere Schwester, dagegen macht einen College-Abschluss und arbeitet danach in verschiedenen Branchen, als Buchhalterin oder Journalistin. Sie schließt sich der Emanzipationsbewegung an, doch insgeheim ist sie auf der Suche nach einer festen Bindung. Wechselnde Bekanntschaften und Affären führen sie schließlich in die Einsamkeit.
Am Ende war alles Lug und Trug und es bewahrheitet sich der erste Satz des Romans: keine der Grimes-Schwestern ist glücklich geworden. Richard Yates erzählt die unterschiedlichen Lebensentwürfe aus der Sicht von Emily, die damit zur eigentlichen Hauptfigur des Romans wird. Sowohl die traumatischen Erlebnisse als auch der belanglose Alltag werden in einer knappen und klaren Sprache geschildert. Geradezu nüchtern und schonungslos zeichnet Yates seine Figuren, aber mitfühlend und mit einer echten Sympathie, die auch den Leser erfasst.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für