Insgesamt 274 Bewertungen
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 7 Zur Seite 7 8 Zur Seite 8 9 Aktuelle Seite 10 Zur Seite 10...Weitere Seiten28Zur letzten Seite, Seite 28Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 7 Zur Seite 7 8 Zur Seite 8 9 Aktuelle Seite 10 Zur Seite 10...Weitere Seiten28Zur letzten Seite, Seite 28Zur nächsten SeiteZur letzten Seite



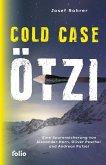
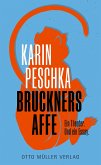
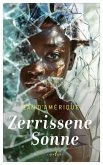


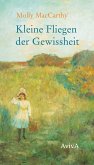
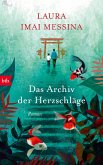
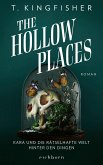
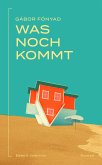
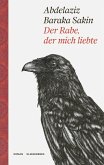
Benutzer