Insgesamt 1268 Bewertungen
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 77 Zur Seite 77 78 Zur Seite 78 79 Aktuelle Seite 80 Zur Seite 80...Weitere Seiten99+Zur letzten Seite, Seite 100Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 77 Zur Seite 77 78 Zur Seite 78 79 Aktuelle Seite 80 Zur Seite 80...Weitere Seiten99+Zur letzten Seite, Seite 100Zur nächsten SeiteZur letzten Seite



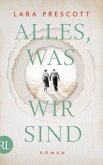

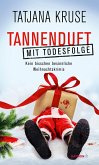

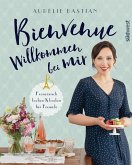
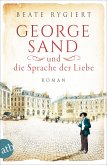
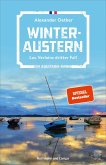
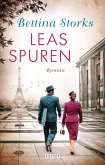
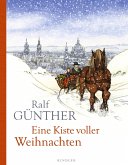
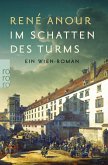
Benutzer