Insgesamt 209 Bewertungen
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 5 Zur Seite 5 6 Zur Seite 6 7 Aktuelle Seite 8 Zur Seite 8...Weitere Seiten21Zur letzten Seite, Seite 21Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 5 Zur Seite 5 6 Zur Seite 6 7 Aktuelle Seite 8 Zur Seite 8...Weitere Seiten21Zur letzten Seite, Seite 21Zur nächsten SeiteZur letzten Seite



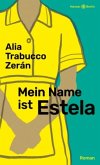
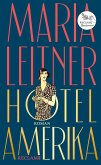
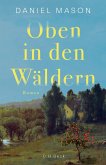
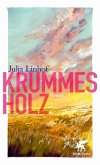


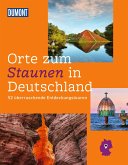
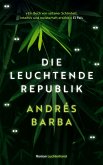
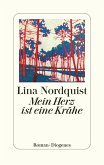
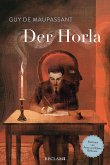
Benutzer