Insgesamt 133 Bewertungen
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4 5 Aktuelle Seite 6 Zur Seite 6...Weitere Seiten14Zur letzten Seite, Seite 14Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4 5 Aktuelle Seite 6 Zur Seite 6...Weitere Seiten14Zur letzten Seite, Seite 14Zur nächsten SeiteZur letzten Seite



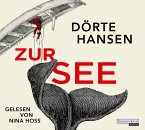
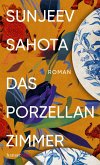
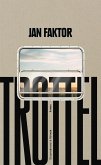
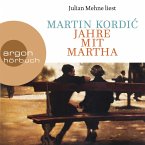
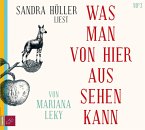





Benutzer