Insgesamt 214 Bewertungen
Zur vorherigen Seite 1 Zur Seite 1 2 Aktuelle Seite 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten22Zur letzten Seite, Seite 22Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
Zur vorherigen Seite 1 Zur Seite 1 2 Aktuelle Seite 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten22Zur letzten Seite, Seite 22Zur nächsten SeiteZur letzten Seite



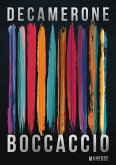

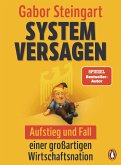
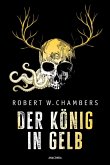

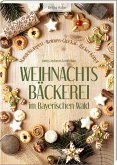
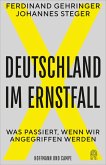
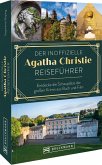


Benutzer