Insgesamt 274 Bewertungen
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 9 Zur Seite 9 10 Zur Seite 10 11 Aktuelle Seite 12 Zur Seite 12...Weitere Seiten28Zur letzten Seite, Seite 28Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 9 Zur Seite 9 10 Zur Seite 10 11 Aktuelle Seite 12 Zur Seite 12...Weitere Seiten28Zur letzten Seite, Seite 28Zur nächsten SeiteZur letzten Seite




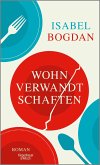
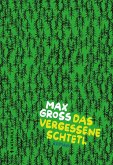

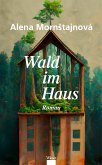

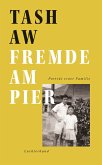
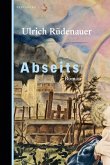


Benutzer