BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 6 Bewertungen| Bewertung vom 02.01.2014 | ||

|
Die Sammlung beginnt mit einem gewaltigen Trauer- und Preisgedicht auf Kreuzigung und Auferstehung, das auch Ungläubige nicht kalt lassen dürfte, vielleicht das sprachmächtigste Werk dieser Art in Alexandrinern, das ich kenne. |
|
| Bewertung vom 02.01.2014 | ||
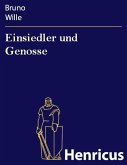
|
Einsiedler und Genosse (eBook, ePUB) Die Lyrik des Bürgertums sei in "leere Nichtigkeit" und "puren Formalismus" verfallen, heißt es in einem Vorwort von Julius Hart zu diesem Band. Dem gegenüber setze Wille in seiner Lyrik ein neues und kraftvolles Innenleben, die Zentren "Mitleid mit Armen und Unterdrückten" und den "Glauben an die ... Entwicklung der Menschheit und ... den Sozialismus" als Erlöser aus der Armut. |
|
| Bewertung vom 02.01.2014 | ||

|
Scherzhafte Lieder (eBook, ePUB) Die deutsche Lyrikgeschichte mag manch Besonderheit aufweisen, überbordenden Humor ganz gewiss nicht. Es finden sich unter den gut 10 dutzend bedeutenden Lyrikern von Luther bis Rilke so wenige wirklich witzige Autoren, dass jeder einzelne davon besonders heraussticht. |
|
| Bewertung vom 02.01.2014 | ||

|
Das Lebensmotto der Louise Aston, das sie in einem ihrer Gedichte angibt, "Freiem Leben, freiem Lieben, Bin ich immer treu geblieben!", scheint wohl auch für ihr eigenes Leben gegolten zu haben. Immer widerspenstig gegen äußere Zwänge, lehnt sie sich schon früh gegen ihre Zwangsverheiratung auf. Auch dieser dann doch statt gefundenen Hochzeit hat sie ein Klagegedicht gewidmet, wird später zur Revolutionärin (eine eigene Gedichtsammlung "Freischärler-Reminiszenzen" erscheint von ihr), und lange Jahre wird sie wegen "unzüchtiger Lebensführung" von der Polizei in mehreren deutschen Bundesstaaten beaufsichtigt, sofern sie nicht gleich ausgewiesen wird. |
|
| Bewertung vom 02.01.2014 | ||

|
Weckherlin war echt europäischer Dichter, mehrsprachig und für seinen schwäbischen Regenten zunächst in Frankreich, dann in England im Dienst, wo er dann auch heiratete und den 30jährigen Krieg von außen auf Seiten der Lutheraner kommentierte. |
|
