Insgesamt 802 Bewertungen
1 Aktuelle Seite 2 Zur Seite 2 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten81Zur letzten Seite, Seite 81Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
1 Aktuelle Seite 2 Zur Seite 2 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten81Zur letzten Seite, Seite 81Zur nächsten SeiteZur letzten Seite





![Die deutsche Stadt im 19. [neunzehnten] Jahrhundert. Stadtplanung und Baugestaltung im industriellen Zeitalter. Studien zur Kunst des neunzehnten Jahrhunderts ; Bd. 24. Forschungsunternehmen der Fritz Thyssen Stiftung. Arbeitskreis Kunstgeschichte.](https://bilder.buecher.de/produkte/27/27164/27164982m.jpg)
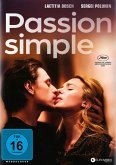
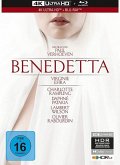
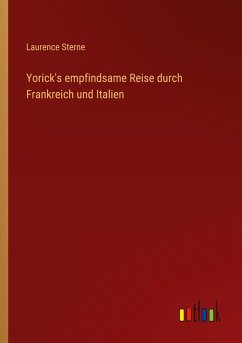

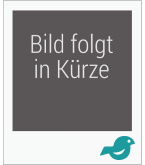
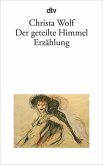
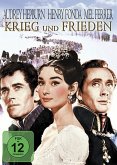
Benutzer