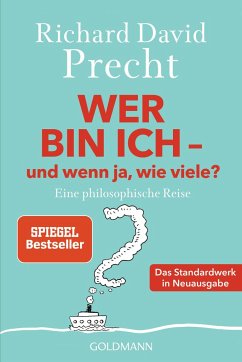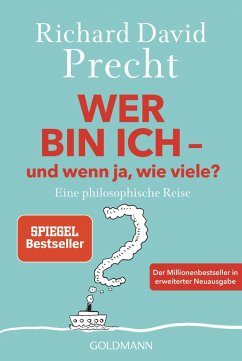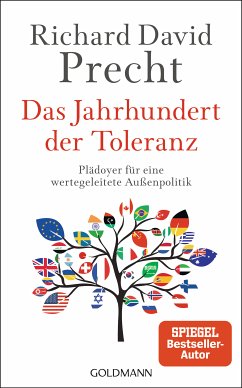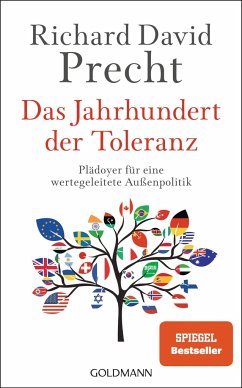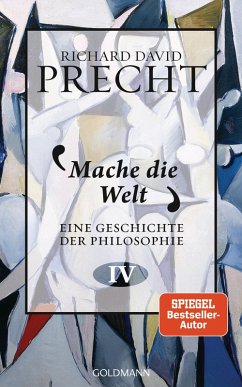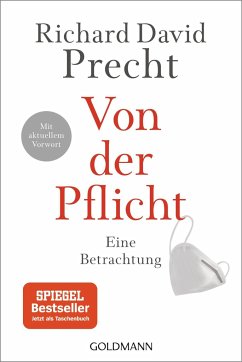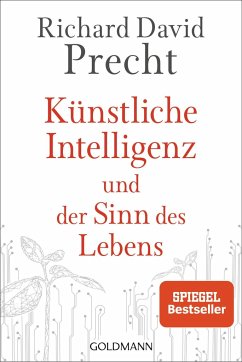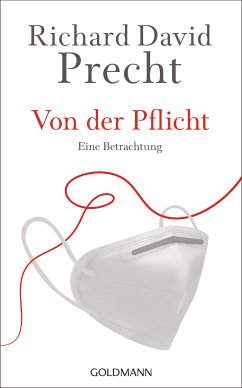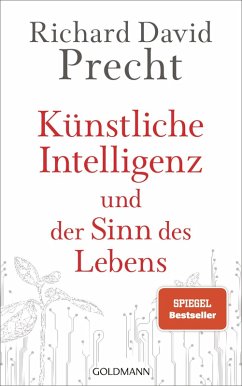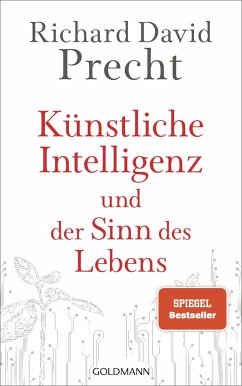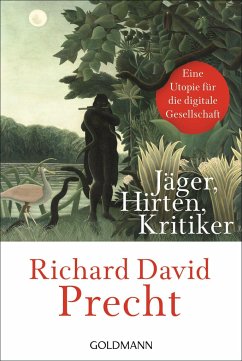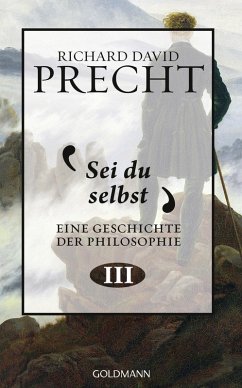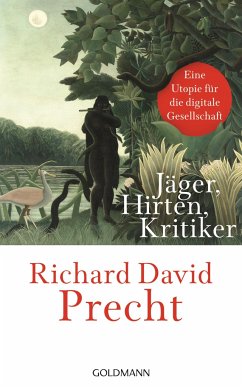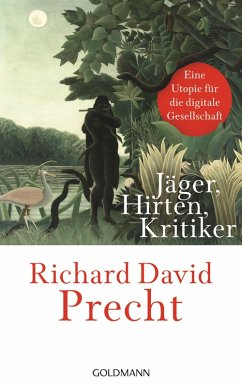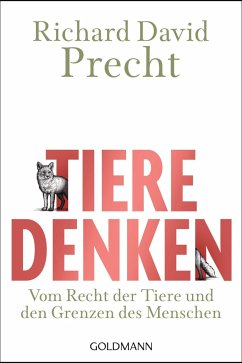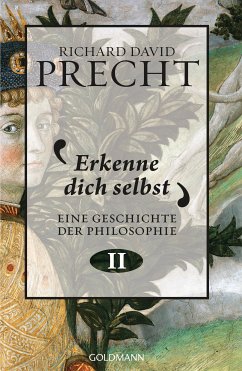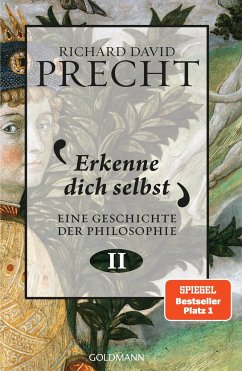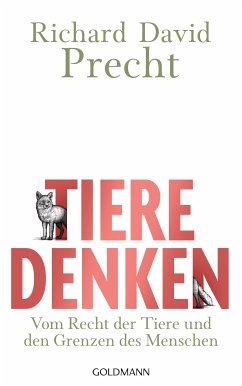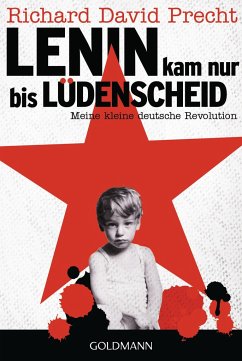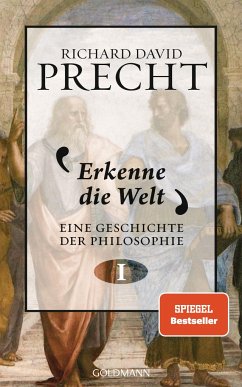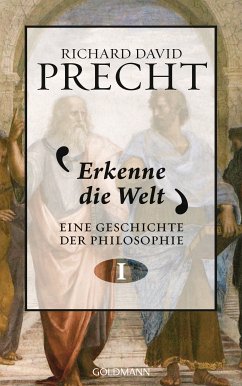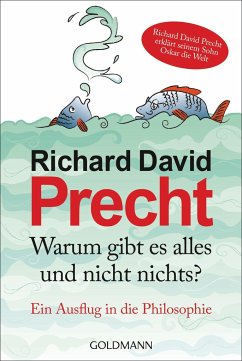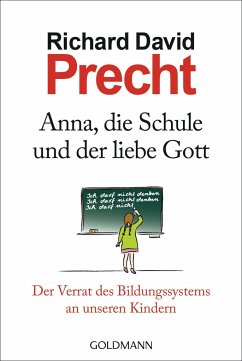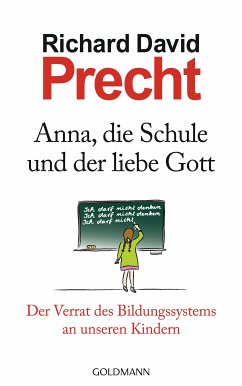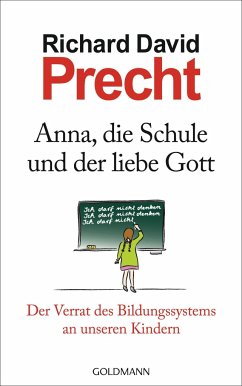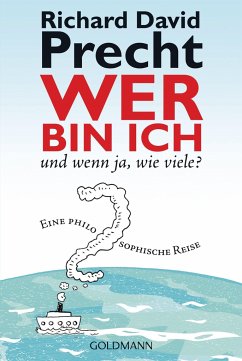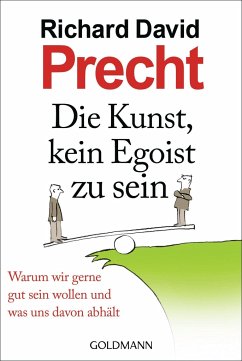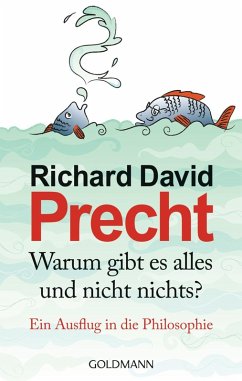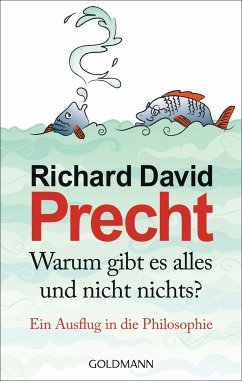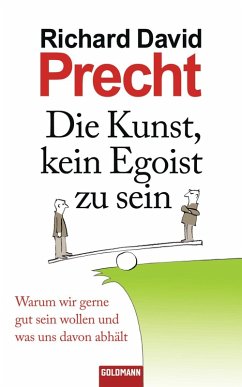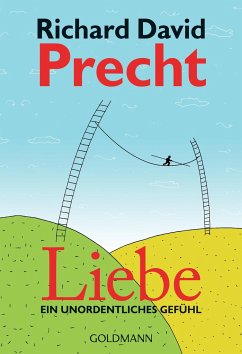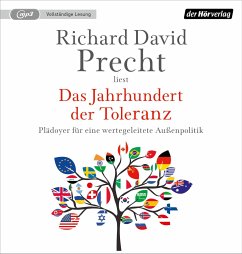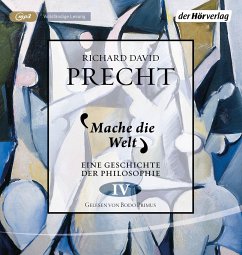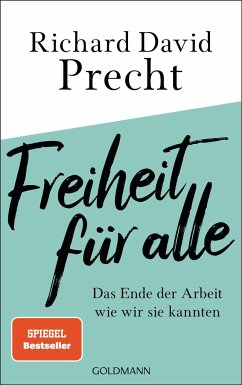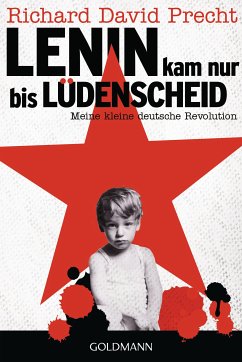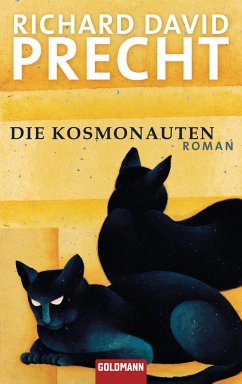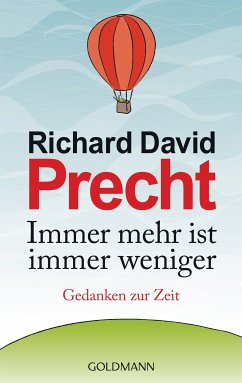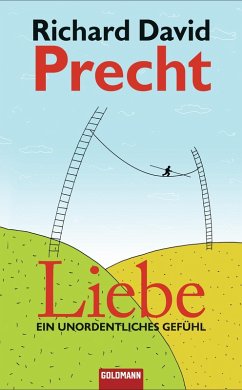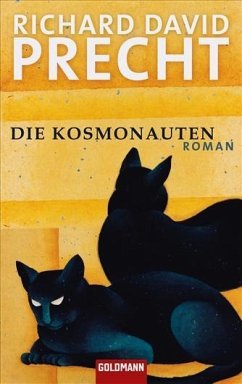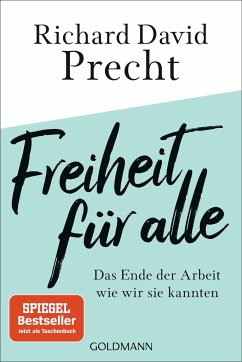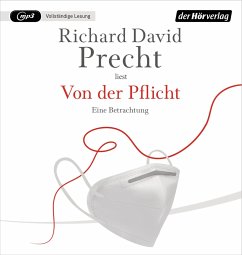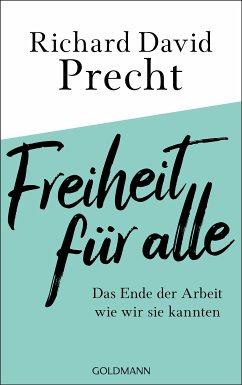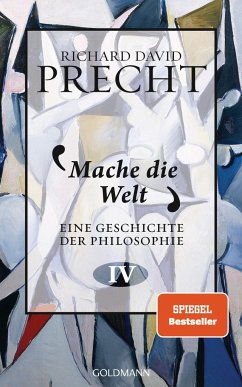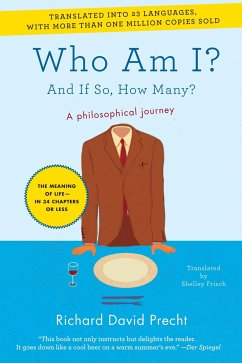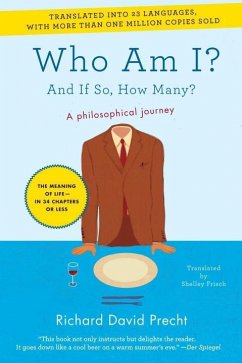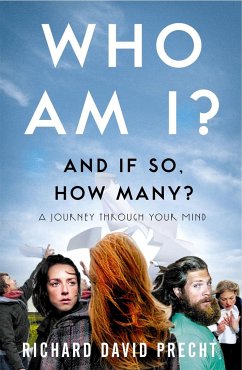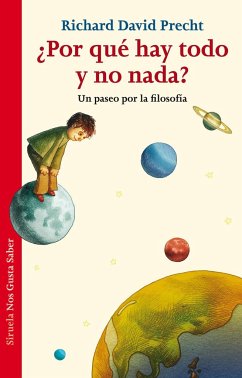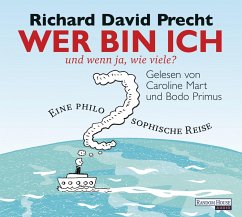© Jens Komossa
Richard D. Precht
Richard David Precht, Philosoph, Publizist und Autor, wurde 1964 in Solingen geboren. Er promovierte 1994 an der Universität Köln und arbeitet seitdem für nahezu alle großen deutschen Zeitungen und Sendeanstalten. Precht war Fellow bei der "Chicago Tribune". Im Jahr 2000 wurde er mit dem Publizistikpreis für Biomedizin ausgezeichnet. Er schrieb zwei Romane und drei Sachbücher. Richard David Precht lebt in Köln und Luxembourg.
Kundenbewertungen
Precht argumentiert auf zwei Säulen: Das egalste auf der Welt seien Hautfarben, denn seine Geschwister kämen aus Vietnam. Und der Kapitalismus durchdringe unser Leben auf das negativste in allen Verästelungen, jeder sei heute ein hypersensibles Marketingprodukt seiner selbst. Deswegen würde man heute nichts mehr er...
Precht argumentiert auf zwei Säulen: Das egalste auf der Welt seien Hautfarben, denn seine Geschwister kämen aus Vietnam. Und der Kapitalismus durchdringe unser Leben auf das negativste in allen Verästelungen, jeder sei heute ein hypersensibles Marketingprodukt seiner selbst. Deswegen würde man heute nichts mehr ertragen und Streit aus dem Weg gehen. Er selbst habe Roger Willemsen auf das heftigste bekämpft, weil dieser damals besser war als er selbst. Erst auf Augenhöhe habe er ihn akzeptiert.
Nun, was Precht hier beschreibt ist Wettbewerb und Kapitalismus pur. Er ist Teil dessen, aber immer noch mit einer unstillbaren Sehnsucht nach seiner eigenen, linken Sozialisation, die alle Unterschiede der Kulturen einebnen und für null und nichtig erklären wollte. Aus diesem Grund blendet Precht auch etwas aus, das ihm als negativ erklärt wurde: Religionen. Heute den Unterschied zwischen Judentum/Christentum und der dritten monotheistischen Religion nicht zu kennen, ist höchst gefährlich. Und aus diesem großen Elefanten speisen sich heute zu 90% alle Probleme. Man kann es lösen wie die SPD in Dänemark oder wie die deutsche Linke: durch völlige Negation.
Der Kapitalismus ist kein System, das dem Menschen äußerlich übergestülpt wurde, sondern die natürlichste Form menschlichen Zusammenlebens, sobald Freiheit und Verantwortung möglich sind. Er wurzelt in demselben Impuls, der jede Kultur antreibt: im Drang, zu schaffen, zu gestalten, zu verbessern. Wer arbeitet, tut das nicht nur, um zu überleben, sondern um sich selbst und die Welt zu formen. In dieser schöpferischen Bewegung liegt Freude – und diese Freude ist keine ideologische Täuschung, sondern eine der elementarsten menschlichen Erfahrungen.
Die alte Industriekritik sah im Kapitalismus eine Maschine der Entfremdung. In Wahrheit hat gerade die Marktwirtschaft die Arbeit aus der Erstarrung des Zwangs befreit. Sie erlaubt, was alle politischen Systeme vor ihr behinderten: dass der Einzelne selbst entscheidet, was er mit seinem Leben anfangen will. Ob jemand Autos zusammenschraubt oder sie entwirft, ob er Programme schreibt, Bücher verlegt oder Brot bäckt – immer gilt: In der freien Wirtschaft kann jeder, der will, sich einbringen, gestalten, sich selbst beweisen. Das ist keine Ideologie, sondern Anthropologie.
Hier berührt sich Ökonomie mit Psychologie. Maslow hat gezeigt, dass der Mensch nach Selbstverwirklichung strebt, sobald seine Grundbedürfnisse erfüllt sind. Diese Selbstverwirklichung ist kein Luxus, sondern Ausdruck des Lebenswillens. Wer etwas leistet, erfährt Sinn. Kapitalismus ist also nicht die ökonomische Pervertierung des Menschlichen, sondern seine Fortsetzung mit anderen Mitteln. Er schafft den Rahmen, in dem Leistung, Kreativität und Verantwortung sich entfalten können. Er ersetzt Zwang durch Möglichkeit.
Der von Reckwitz und Precht beklagte „kulturelle Kapitalismus“ ist in Wahrheit ein Missverständnis. Wenn Menschen sich heute selbst verwirklichen wollen, dann tun sie das nicht, weil sie vom Markt getrieben werden, sondern weil sie leben wollen. Der Kapitalismus instrumentalisiert nicht das Menschliche – er bietet ihm Raum. Was seine Kritiker als Selbstverwertung deuten, ist in Wirklichkeit Selbstgestaltung. Nicht jeder, der seine Talente einsetzt, „vermarktet“ sich. Viele schaffen, weil sie sich im Tun erkennen. Freude an Arbeit ist keine Anpassung, sondern ein Zeichen von Lebendigkeit. Wer unternehmerisch denkt, denkt nicht nur an Profit, sondern an Verbesserung. Er will etwas, das vorher nicht da war. So wird Wirtschaft zu einem fortgesetzten schöpferischen Prozess, zu einer alltäglichen Kunstform.
Der Kapitalismus in seiner besten Ausprägung ist also nichts anderes als die ökonomische Entsprechung der Aufklärung. Er setzt auf Vernunft, Eigeninitiative, Verantwortung und Vertrauen in die Fähigkeit des Menschen, selbst zu entscheiden. Er zwingt niemanden zu Gleichheit im Ergebnis, sondern eröffnet Freiheit im Versuch. Darin liegt seine Moral: nicht im Verteilen, sondern im Ermöglichen. Seine Würde liegt in der Anerkennung des Individuums als Quelle aller Wertschöpfung.
Natürlich braucht dieser Kapitalismus Maß, Recht, Kultur und Ethik. Aber er braucht keine Scham. Wer Produkte erfindet, Dienstleistungen anbietet, Risiken trägt oder Märkte schafft, ist kein Profiteur, sondern Träger des Fortschritts. Der Kapitalismus ist kein Fremdkörper im Menschlichen, sondern seine produktive Energie in organisierter Form. Er hat mehr Menschen aus Armut befreit, mehr Wissen erzeugt und mehr Kreativität freigesetzt als jedes andere System zuvor.
Der Mensch ist kein Opfer der Märkte. Er ist ihr Ursprung. Der Kapitalismus, richtig verstanden, ist nicht die Ökonomisierung des Lebens, sondern seine Entfesselung. Er verwandelt Bedürfnis in Handlung, Idee in Tat, Möglichkeit in Wirklichkeit. Darum ist er, bei aller Unvollkommenheit, die menschlichste aller Lebensformen: weil er den Menschen in seiner schöpferischen Freiheit ernst nimmt.
Wir lesen in diesem Buch wunderbare, hochmoralische Sätze wie: „Das Leben eines Menschen ist gleich viel wert, egal welchen Geschlechts er ist, welche Hautfarbe er hat und wo auch immer in der Welt er lebt.“
Gleich darauf folgt die Anklage Richtung Abendland bzw. seiner eigenen Herkunft: „Und doch stufen wir,...
Wir lesen in diesem Buch wunderbare, hochmoralische Sätze wie: „Das Leben eines Menschen ist gleich viel wert, egal welchen Geschlechts er ist, welche Hautfarbe er hat und wo auch immer in der Welt er lebt.“
Gleich darauf folgt die Anklage Richtung Abendland bzw. seiner eigenen Herkunft: „Und doch stufen wir, wenn Europa wichtiger ist als Afrika, implizit die Menschenwürde ab in Wir, die anderen und die ganz anderen.“
Aha, hier hätte ich eigentlich aufhören können mit dem Lesen, ging aber weiter und gab Precht noch einige Chancen. Nicht jeder hat Enzensberger gelesen oder die Rhetorik Frantz Fanons bzw. ihre Gegenaggression verstanden.
„In der Abenddämmerung der Sozialdemokratie hat dagegen Rousseau noch einmal gesiegt. Sie haben nicht die Produktionsmittel, sondern die Therapie verstaatlicht. Dass der Mensch von Natur aus gut sei, diese merkwürdige Idee hat in der Sozialarbeit ihr letztes Reservat. Pastorale Motive gehen dabei eine seltsame Mischung ein mit angejahrten Milieu- und Sozialisationstheorien und mit einer entkernten Version der Psychoanalyse. Solche Vormünder nehmen in ihrer grenzenlosen Gutmütigkeit den Verirrten jede Verantwortung für ihr Handeln ab.“ („Aussichten auf den Bürgerkrieg“, 1994, S. 37)
Es ist grundsätzlich unmöglich zu definieren, was denn überhaupt "Gerechtigkeit" ist, sie herzustellen ist universell für alle Kulturen unmöglich. Aus diesem Grunde ist es hoch-notwenig, Europa werteorientiert zu definieren, die anderen Kulturen zu erfassen und die ganz anderen in ihren Differenzen zu verstehen.
Diese dramatischen Differenzen im Islam nimmt Precht nicht zur Kenntnis, er meint im Kapitel „Unzeitgemäße Feindbilder“ der Islam würde sich nicht als Gegenpol bzw. neuer Konkurrent eignen. „Vom vermeintlich gleichen Weltherrschaftswahn getrieben, trat im Deutungsmuster des Westens nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus in Osteuropa der Islam auf den Plan.“ Den von Huntington beschriebenen Kulturkampf sieht Precht nicht, weil „die islamische Welt bildete auch damals ein völlig zerstrittenes Ensemble und keine politisch und kriegerisch geschlossene Einheit.“
Vermutlich würde Precht, wenn er denn den Islam je gelesen und verstanden hätte, diesen auch kritisieren und seine überdauernde Einheit und Gefahr dann erkennen, wenn er diese Religion und Ideologie auf öffentlichen Plätzen endlich analysieren würde. Ob die von Precht postulierten Werte aus dem Oberkommando Weltmoral auf das Verhältnis zu Frauen passt, könnte er studieren in diesem Buch eines türkischen Verfassungsrechtler: "Frauen sind Eure Äcker", von Ilhan Arsel.
Wir alle schreiben ab und zu, besonders gut kann dies Precht. Das 21. Jahrhundert ist keine Zeit der Toleranz, sondern ein harter Kulturkampf zwischen völlig unterschiedlichen Erklärungsmustern der Menschenrechte. Toleranz im westlichen Sinne wird von der islamischen Welt unter dem dramatischen Vorbehalt der Scharia gesehen. Nichts verbindet die Kultur des Islam mit der des Christlichen Abendlandes, auch wenn Herr Precht weiter sucht, eine Erd-Charta, ein einheitliches Weltethos ist unmöglich.
Nach einigen Konflikten mit dem Mainstream sehe ich dieses Buch als Wunsch der Wiedereingliederung des großen Philosophen Precht in die richtige Denkweise wertegeleiteter Außenpolitik, die schon dann versagt, wenn Bergkarabach von Deutschland alleine gelassen wird, um Gas in Aserbaidschan zu kaufen. Was mir in vielen Büchern/Veröffentlichungen auffiel: Precht hat in der differenzierten Betrachtung von Religionen und dem unverrückbaren Standpunkt des Islam wenig verstanden und kann seine Folgen nicht erkennen. Auch hier sei Enzensberger empfohlen: „Die Schreckensmänner. Versuch über den radikalen Verlierer" (edition suhrkamp)
4 von 6 finden diese Rezension hilfreich