der Fußball-Bundesliga für Furore und Stirnrunzeln sorgt, ist der heimliche Hauptdarsteller von "Hoffenheim - Das Leben ist kein Heimspiel", der jetzt auf dem "Filmfestival Max Ophüls Preis" in Saarbrücken Premiere hatte. Mehr als vier Jahre haben Frank Marten Pfeiffer und Rouven Rech den Verein begleitet, und wenn man Rotthaus und der TSG eines hoch anrechnen muss, dann, dass sie diesen Film überhaupt zugelassen und später auch keine kleinlichen Kürzungen erzwungen haben. Denn nicht immer kommen sie gut weg. Rech und Pfeiffer zeigen, wie aus einem verschlafenen Provinzclub ein Fußballkonzern gebastelt wird, wie PR-Denken und Werbesprache den Fußball kapern und Traditionsvereine durch Retortenclubs ersetzt werden. Im Zentrum des Films steht einerseits die Saison 2007/2008, als der Aufsteiger aus der Regionalliga sich mit einem Etat, der höher lag als der aller anderen Zweitligisten zusammen, den Bundesliga-Aufstieg de facto gekauft hat, als parallel dazu ein internationalen Standards genügendes Stadion aus dem Kraichgauer Acker gestampft wurde und Rotthaus den Club per umfassender Imagekampagne neu erfand. "Früher waren es Fans und Spiele, heute sind es Kunden und Produkte", resümiert ein langjähriger Fan, und es wird klar, dass die Geschichte von "Hoffenheim - Das Leben ist kein Heimspiel" vor allem ein großartiges Lehrstück des Neoliberalismus ist, ein Fallbeispiel darüber, wie Marketing und Effizienzdenken alle anderen Lebensbereiche übernehmen. Bleibt noch die Frage, ob ein solches Modell auch in der Politik funktionieren könnte.
Die Folgen des Ökonomismus für jene "Soft Skills", die man früher einmal Seele nannte, sind ein zentrales Motiv auch von "Schwerkraft" des Berliners Maximilian Erlenwein, der völlig verdient den Max-Ophüls-Preis 2010 bekam und mit drei weiteren Preisen zum überragenden Sieger wurde. Fabian Hinrichs spielt Frederick, einen Bankangestellten mit dunklen Seiten. Er lebt das graue Leben eines Anzugträgers, der faule Kredite verkauft und abends in der leeren Wohnung zunehmend an sich verzweifelt. Als sich auch noch ein bankrotter Kunde vor seinen Augen tötet, wahrt Frederick die Form, kündigt aber innerlich und beginnt, gemeinsam mit einem Bekannten von früher - Jürgen Vogel als Exknacki, der gern Spießer wäre - nachts die Villen der Reichen auszurauben. Hinrichs' Auftritt als Borderline-Person ist großartig und der Schauspielpreis die überfällige Anerkennung für einen der intensivsten Darsteller seiner Generation; Nora von Waldstätten (beste Nachwuchsdarstellerin) ist als Fredericks Exfreundin, nach der er sich weiterhin verzehrt, kaum weniger bezwingend. Die größte Entdeckung aber ist der Regisseur selbst. Freude am Krimi-Genre mischt er stilsicher mit lakonisch-absurdem Humor, der an Tarantino erinnert, zu einer anarchisch-subversiven Komödie, die den Zuschauer die Sehnsucht nach dem intensiven Leben ernst nehmen und nachempfinden lässt. Lange nicht ist man einer Figur bereitwilliger auf die schiefe Bahn gefolgt.
Der übrige Wettbewerb war solide und ohne große Schwachpunkte, es fehlten aber die wirklich radikalen und kontroversen Stoffe, wie man sie von der Saarbrücker Mischung aus Hochschul-Nachwuchs, Debütanten und jungen Filmemachern eigentlich erwarten muss.
Ein Werk allerdings kam dieser Erwartung nach: Philip Kochs "Picco" (Regiepreis), ein schockierendes, so knallhartes wie erschütterndes Knastdrama. Koch rekonstruierte jenen Foltermord, der sich 2006 in einer Gefängniszelle in Siegburg ereignete, im Spielfilmformat. Die dramaturgische Überhöhung funktionierte nur zum Teil, zumal die Dialoge sehr "geschrieben" klangen, vor allem aber, weil deutsche Schauspieler, wenn sie in säuberlich verschmutzten Räumen kaputte Proleten spielen, am Ende eben doch immer vor allem deutsche Schauspieler bleiben. Man hat immer den Verdacht, dass die tatsächlichen Akteure dieser "wahren Geschichte" noch um einiges unterträglicher wären, stünden sie im Raum. Doch "Picco" war ein intensives, produktiv unangenehmes Kammerspiel, das einen auch nach Tagen nicht losließ - und dies nicht allein aus sozialpädagogischer Beunruhigung.
Auch Andreas Arnstedts "Die Entbehrlichen" ließe sich unter "Sozialdrama" subsummieren, hätte der Regisseur seinen Film nicht geschickt ins Traumhafte überhöht. Auch gelingt es Arnstedt, in seinem deprimierenden Plot - ein Zwölfjähriger lebt tagelang mit dem toten Vater allein in der Wohnung und erinnert sich an sein Leben als Alkoholikerkind - komische Seiten zu finden. Mit André Hennecke hat der Film zudem einen Hauptdarsteller, dem man stundenlang zusehen mag - selbst da, wo er mal chargiert. Am Rande des Festivals erklärte Hennecke seinen Austritt aus der Deutschen Filmakademie, weil der Low-Budget-Film im Vorauswahlverfahren für den Deutschen Filmpreis verfahrenswidrig benachteiligt worden sei.
Gleichfalls mit verhältnismäßig wenig Geld, aber ungleich aufwendiger inszeniert wurde "Waffenstillstand" von Lancelot von Naso, der vor allem interessant ist, weil er etwas versucht, was man im deutschen Kino sonst kaum sieht: ein Genrestück von einem aktuellen Kriegsschauplatz. Wie in John Fords "Stagecoach" setzt der Film ein paar ungleiche Typen (ein deutsches Kamerateam und zwei Ärzte plus Fahrer) in einen Jeep und lässt sie durch die Kampflinien des Irak-Kriegs nach Falludscha fahren. Während die Dialoge zu geschwätzig sind und man auf die eine oder andere Wendung gern verzichtet hätte, besticht der gut erzählte "Waffenstillstand" mit eindringlichen Bildern und immer wieder irritierenden Momenten. Ein spannender Einblick in moderne Kriege, fast ohne Betroffenheitskitsch.
Wie bei Naso konnte man in vielen Saarbrücker Filmen eine neue Lust am Genre, am Spiel mit Formeln und Motiven entwickeln. Blau mag eine kalte Farbe sein. Aber sie ist auch die Farbe der Sehnsucht nach einem anderen Kino, wie sie in vielen Filmen zum Ausdruck kommt.
RÜDIGER SUCHSLAND
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
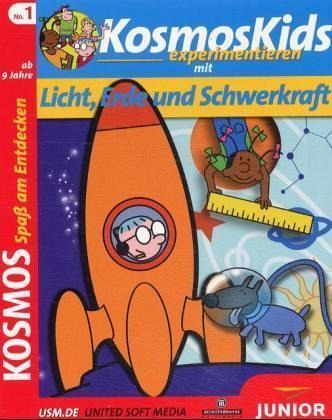





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.01.2010
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.01.2010