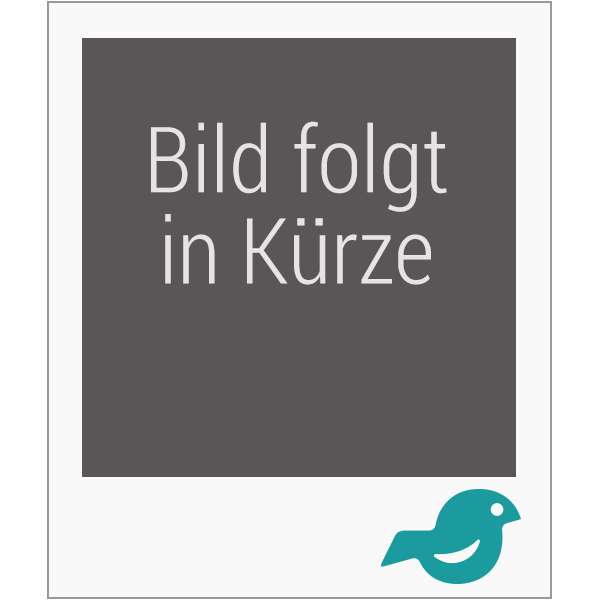
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Audio-CD
La fida Ninfa (Gesamtaufnahme)
Nicht lieferbar



Produktdetails
- Anzahl: 2 Audio CDs
- Erscheinungstermin: 31. Dezember 1990
- Hersteller: AIG / Dynamic,
- EAN: 8071440601456
- Artikelnr.: 25064124
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.10.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.10.2019Die heilende Kraft des Idylls
Klug und liebevoll: Das Theater Regensburg zeigt Vivaldis Oper "La fida ninfa"
Gerade jetzt, in den letzten Tagen des Aufschubs vor dem Dunkel, wenn sich der Nebel schon in die Gassen schmiegt, die Sonne aber noch immer versichert, der Sommer sei gar nicht gestorben, und wir ihr auf wenige Stunden Glauben schenken, weil die Luft am Nachmittag warm und die Silberweiden an der Donau noch voller Laub sind, gerade jetzt ist Regensburg unwiderstehlich. Das Theater, in dem sich das Fürstenhaus von Thurn und Taxis und die Bürgerstadt schon früh einander zugeneigt haben, ist in seinem Klassizismus aus dem Weiß, Gold, Purpur und Azur des Innenraums gewiss unter die zehn schönsten Deutschlands
Klug und liebevoll: Das Theater Regensburg zeigt Vivaldis Oper "La fida ninfa"
Gerade jetzt, in den letzten Tagen des Aufschubs vor dem Dunkel, wenn sich der Nebel schon in die Gassen schmiegt, die Sonne aber noch immer versichert, der Sommer sei gar nicht gestorben, und wir ihr auf wenige Stunden Glauben schenken, weil die Luft am Nachmittag warm und die Silberweiden an der Donau noch voller Laub sind, gerade jetzt ist Regensburg unwiderstehlich. Das Theater, in dem sich das Fürstenhaus von Thurn und Taxis und die Bürgerstadt schon früh einander zugeneigt haben, ist in seinem Klassizismus aus dem Weiß, Gold, Purpur und Azur des Innenraums gewiss unter die zehn schönsten Deutschlands
Mehr anzeigen
zu rechnen. Doch was wäre dieser Raum ohne die Beseelung, die nur die Kunst ihm geben kann?
In diesem Raum wird nun eine Rarität gezeigt, die auf der Bühne zu sehen man in Europa lang warten oder weit reisen muss: Antonio Vivaldis Oper "La fida ninfa", 1732 komponiert, ein Hirten-und-Nymphen-Techtelmechtel, von der Handlung her so harmlos wie von der Musik ergreifend. Denn Vivaldi zeigt sich hier ganz als Lyriker, der fast jede Arie mit einer langen unbegleiteten messa di voce, dem An- und Abschwellen der Singstimme auf einem Ton, beginnen lässt, um die Hörer mitten ins Herz zu treffen. Es geht um ein Theater der Rührung und der Anteilnahme, um ein Theater der Barmherzigkeit angesichts der Möglichkeit - wie sie der Tenor Brent L. Damkier als Vater Narete in einem erschütternden Moment singend entwirft - im Leben eines jeden Menschen, sei er auch noch so mächtig, in Not und Abhängigkeit zu geraten.
Diese messa di voce, auf die sich die Sopranistinnen Anna Pisareva als Licori und Sara-Maria Saalmann als Morasto genauso gut verstehen wie die Mezzosopranistin Vera Semieniuk als Elpina und der Countertenor Onur Abaci als Osmino, durchmisst ja auf einem Ton den Raum, dringt vom Singenden zum Hörenden und wieder zurück, zeigt die Sehnsucht des Ich nach einem Du, aber auch die auf sich selbst zurückgeworfene Verinnerlichung des Affekts an, der dadurch schon fast zum viel persönlicheren Gefühl wird. Auf jeden Fall setzt der Dirigent Tom Woods in Regensburg musikalisch viel weniger auf das geräuschvolle Durchpeitschen von Affekten, auf eine klatschende, kratzende, keifende Rhetorik, wie sie bei manchen Originalklangensembles heute zur Marotte geworden ist. Woods würdigt Vivaldi vielmehr als einen Denker, der Harmonik als Architektur begriff, als Kunst, mittels einer zentralperspektivisch gedeuteten Grundtonart Entfernungen zu entwerfen und zu durchschreiten. Schon die einleitende Sinfonia definiert durch die Grundfunktionen der Kadenz, verstärkt durch Echoeffekte, den Raum in alle Richtungen.
Das Philharmonische Orchester Regensburg leistet dabei Erstaunliches. Es ist, genauso wenig wie die Sänger, die allesamt aus dem Ensemble stammen und neben Vivaldi auch Verdi, Puccini oder Richard Rodgers singen, kein Spezialensemble für Alte Musik. Trotzdem spielen die Streicher fast ohne Vibrato und lassen lange Töne entsprechend alter Praxis bauchig an- und abschwellen. Und obwohl moderne Ventiltrompeten und Hörner zum Einsatz kommen, genügt offenbar schon die Anwesenheit einer Theorbe und einer Barockgitarre (gespielt von Gudrun Petruschka), um zu einer völlig anderen Tongebung zu gelangen: schärfer, aber leiser, entschiedener, aber versehrbarer. Im Schlussbild, wenn Maria-Magdalena Fleck als Juno aus der Wolkengondel im Reifrock wie ein Funkenmariechen Liebeslutscher und Luftballons wirft und Selcuk Hakan Tirasoglu als blähbauchiger Äolus - die Kostümbildnerin Janina Ammon hat ihn quasi als Shrek in Blau entworfen - seine Winde wehen lässt, dann wechselt Arturo Del Bo im Orchestergraben vom Cembalo zu einer mitteltönig gestimmten, zahnschmelzzersprengenden Elektroorgel, die unmissverständlich klarmacht, dass sich hier gerade der Wirklichkeitsakzent gewaltig verschiebt.
Das ist gedanklich das Zentrum der überaus klugen, liebevollen Inszenierung von Johannes Pölzgutter. Er hat aus dem Hirten-und-Nymphen-Stück eine moderne Geschichte über Bürgerkrieg, Menschenhandel und Prostitution gemacht, ohne dabei explizit zu werden. Narete ist mit seinen beiden Töchtern Licori und Elpina in der Gewalt von Oralto, dem der Bariton Johannes Mooser eine von Gewaltsamkeit verschüttete Weichheit belässt. Morasto, aus dem gleichen Land wie die Übrigen entführt, ist zu einem Vertrauten des Menschenhändlers geworden. Osmino, ebenfalls entführt, wird in der Zwangsprostitution missbraucht, was überaus dezent erzählt wird: Ein Klient von Oralto zieht ihm ein Hasenkostüm an und verschwindet mit ihm ins Nebenzimmer. Wir sehen nicht, was Osmino angetan wird, wir können es aber ahnen, wenn er mit erloschenem Blick nach ein paar Minuten wieder herauskommt. Pölzgutter braucht weder Schlauchboote auf dem Meer noch Vergewaltigungsposen, um auf die Verheerungen unserer Gegenwart aufmerksam zu machen. Seine Verstörungen sind leiser, dafür eindringlicher.
In dieser hoffnungslosen Welt tröstet Vater Narete seine Töchter und bald auch Osmino mit einer Kinderbuchausgabe von Longos' antikem Schäferroman "Daphnis und Chloe" voller Pappbilder zum Ausklappen. Und siehe da: Das Buch wird zum Paralleluniversum der Hoffnungslosen! Die Bühne verwandelt sich in ein barockes Theater mit Papp-Prospekten von Bäumen, Pilzen und Schafen, alle wie mit schwarzer Tinte auf weißes Papier gezeichnet. Das Idyll der Kunst schenkt den Getriebenen ein Intermezzo des Durchatmens, in dem sie sich selbst erkennen. Morasto und Osmino werden gewahr, dass sie Brüder sind, zu unterschiedlichen Zeiten verschleppt, als Kinder schon von ihren Familien den Schwestern Licori und Elpina versprochen. Das Idyll zeigt heilende Kraft.
Wie in der barocken Zauberoper üblich, bringen Pölzgutter und sein Bühnenbildner Manuel Kolip die gesamte Bühnenmaschinerie zum Einsatz, lassen Innen- und Außenring der modernen Drehbühne sich in Gegenrichtung bewegen, um wie in einer traditionellen Ritualkultur die Verwandlung von Welt in Gegenwelt zu zeigen, auch um Zauber und Desillusionierung in einer Drehung miteinander zu verzwirnen. Unsere Zeit, die das Idyll mehr im Reflex denn aus Reflexion mit dem Beiwort "falsch" versieht, kann hier erfahren, dass das Idyll etwas Exterritoriales in einer gewaltsam zerzausten Welt ist, ein kostbarer Moment des Aufschubs.
JAN BRACHMANN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
In diesem Raum wird nun eine Rarität gezeigt, die auf der Bühne zu sehen man in Europa lang warten oder weit reisen muss: Antonio Vivaldis Oper "La fida ninfa", 1732 komponiert, ein Hirten-und-Nymphen-Techtelmechtel, von der Handlung her so harmlos wie von der Musik ergreifend. Denn Vivaldi zeigt sich hier ganz als Lyriker, der fast jede Arie mit einer langen unbegleiteten messa di voce, dem An- und Abschwellen der Singstimme auf einem Ton, beginnen lässt, um die Hörer mitten ins Herz zu treffen. Es geht um ein Theater der Rührung und der Anteilnahme, um ein Theater der Barmherzigkeit angesichts der Möglichkeit - wie sie der Tenor Brent L. Damkier als Vater Narete in einem erschütternden Moment singend entwirft - im Leben eines jeden Menschen, sei er auch noch so mächtig, in Not und Abhängigkeit zu geraten.
Diese messa di voce, auf die sich die Sopranistinnen Anna Pisareva als Licori und Sara-Maria Saalmann als Morasto genauso gut verstehen wie die Mezzosopranistin Vera Semieniuk als Elpina und der Countertenor Onur Abaci als Osmino, durchmisst ja auf einem Ton den Raum, dringt vom Singenden zum Hörenden und wieder zurück, zeigt die Sehnsucht des Ich nach einem Du, aber auch die auf sich selbst zurückgeworfene Verinnerlichung des Affekts an, der dadurch schon fast zum viel persönlicheren Gefühl wird. Auf jeden Fall setzt der Dirigent Tom Woods in Regensburg musikalisch viel weniger auf das geräuschvolle Durchpeitschen von Affekten, auf eine klatschende, kratzende, keifende Rhetorik, wie sie bei manchen Originalklangensembles heute zur Marotte geworden ist. Woods würdigt Vivaldi vielmehr als einen Denker, der Harmonik als Architektur begriff, als Kunst, mittels einer zentralperspektivisch gedeuteten Grundtonart Entfernungen zu entwerfen und zu durchschreiten. Schon die einleitende Sinfonia definiert durch die Grundfunktionen der Kadenz, verstärkt durch Echoeffekte, den Raum in alle Richtungen.
Das Philharmonische Orchester Regensburg leistet dabei Erstaunliches. Es ist, genauso wenig wie die Sänger, die allesamt aus dem Ensemble stammen und neben Vivaldi auch Verdi, Puccini oder Richard Rodgers singen, kein Spezialensemble für Alte Musik. Trotzdem spielen die Streicher fast ohne Vibrato und lassen lange Töne entsprechend alter Praxis bauchig an- und abschwellen. Und obwohl moderne Ventiltrompeten und Hörner zum Einsatz kommen, genügt offenbar schon die Anwesenheit einer Theorbe und einer Barockgitarre (gespielt von Gudrun Petruschka), um zu einer völlig anderen Tongebung zu gelangen: schärfer, aber leiser, entschiedener, aber versehrbarer. Im Schlussbild, wenn Maria-Magdalena Fleck als Juno aus der Wolkengondel im Reifrock wie ein Funkenmariechen Liebeslutscher und Luftballons wirft und Selcuk Hakan Tirasoglu als blähbauchiger Äolus - die Kostümbildnerin Janina Ammon hat ihn quasi als Shrek in Blau entworfen - seine Winde wehen lässt, dann wechselt Arturo Del Bo im Orchestergraben vom Cembalo zu einer mitteltönig gestimmten, zahnschmelzzersprengenden Elektroorgel, die unmissverständlich klarmacht, dass sich hier gerade der Wirklichkeitsakzent gewaltig verschiebt.
Das ist gedanklich das Zentrum der überaus klugen, liebevollen Inszenierung von Johannes Pölzgutter. Er hat aus dem Hirten-und-Nymphen-Stück eine moderne Geschichte über Bürgerkrieg, Menschenhandel und Prostitution gemacht, ohne dabei explizit zu werden. Narete ist mit seinen beiden Töchtern Licori und Elpina in der Gewalt von Oralto, dem der Bariton Johannes Mooser eine von Gewaltsamkeit verschüttete Weichheit belässt. Morasto, aus dem gleichen Land wie die Übrigen entführt, ist zu einem Vertrauten des Menschenhändlers geworden. Osmino, ebenfalls entführt, wird in der Zwangsprostitution missbraucht, was überaus dezent erzählt wird: Ein Klient von Oralto zieht ihm ein Hasenkostüm an und verschwindet mit ihm ins Nebenzimmer. Wir sehen nicht, was Osmino angetan wird, wir können es aber ahnen, wenn er mit erloschenem Blick nach ein paar Minuten wieder herauskommt. Pölzgutter braucht weder Schlauchboote auf dem Meer noch Vergewaltigungsposen, um auf die Verheerungen unserer Gegenwart aufmerksam zu machen. Seine Verstörungen sind leiser, dafür eindringlicher.
In dieser hoffnungslosen Welt tröstet Vater Narete seine Töchter und bald auch Osmino mit einer Kinderbuchausgabe von Longos' antikem Schäferroman "Daphnis und Chloe" voller Pappbilder zum Ausklappen. Und siehe da: Das Buch wird zum Paralleluniversum der Hoffnungslosen! Die Bühne verwandelt sich in ein barockes Theater mit Papp-Prospekten von Bäumen, Pilzen und Schafen, alle wie mit schwarzer Tinte auf weißes Papier gezeichnet. Das Idyll der Kunst schenkt den Getriebenen ein Intermezzo des Durchatmens, in dem sie sich selbst erkennen. Morasto und Osmino werden gewahr, dass sie Brüder sind, zu unterschiedlichen Zeiten verschleppt, als Kinder schon von ihren Familien den Schwestern Licori und Elpina versprochen. Das Idyll zeigt heilende Kraft.
Wie in der barocken Zauberoper üblich, bringen Pölzgutter und sein Bühnenbildner Manuel Kolip die gesamte Bühnenmaschinerie zum Einsatz, lassen Innen- und Außenring der modernen Drehbühne sich in Gegenrichtung bewegen, um wie in einer traditionellen Ritualkultur die Verwandlung von Welt in Gegenwelt zu zeigen, auch um Zauber und Desillusionierung in einer Drehung miteinander zu verzwirnen. Unsere Zeit, die das Idyll mehr im Reflex denn aus Reflexion mit dem Beiwort "falsch" versieht, kann hier erfahren, dass das Idyll etwas Exterritoriales in einer gewaltsam zerzausten Welt ist, ein kostbarer Moment des Aufschubs.
JAN BRACHMANN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben


