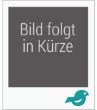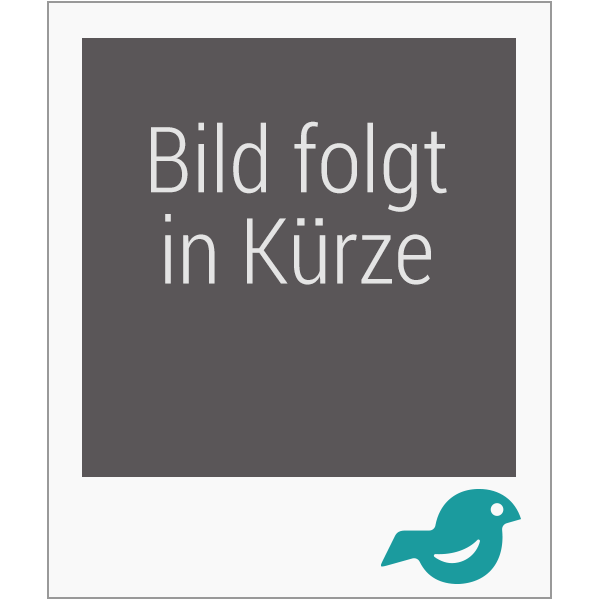Arnold Bennett
Audio-CD
Hotel Grand Babylon, 3 Audio-CDs
Sorgsam gekürzte Lesung. 264 Min.
Gesprochen von Thalbach, Katharina
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





Der Amerikaner Theodore Racksole ist einer der reichsten Männer der Welt -
und ein Freund schneller Entschlüsse. Weil ihm das Benehmen eines Oberkellners mißfällt, kauft er während seines Urlaubs in London kurzerhand das ganze Hotel. Als Racksole den Küchenchef beim Einbalsamieren einer Leiche ertappt, beginnen er und seine Tochter Nella zu ahnen, daß seine neuen Angestellten noch ganz andere Dinge auf dem Kerbholz haben. Ein turbulentes Verwirrspiel um einen geheimnisvollen Mord beginnt ...
und ein Freund schneller Entschlüsse. Weil ihm das Benehmen eines Oberkellners mißfällt, kauft er während seines Urlaubs in London kurzerhand das ganze Hotel. Als Racksole den Küchenchef beim Einbalsamieren einer Leiche ertappt, beginnen er und seine Tochter Nella zu ahnen, daß seine neuen Angestellten noch ganz andere Dinge auf dem Kerbholz haben. Ein turbulentes Verwirrspiel um einen geheimnisvollen Mord beginnt ...
Arnold Bennett (1867-1931) wuchs in einfachen Verhältnissen im nordenglischen Staffordshire auf. Nach einigen Jahren in der Anwaltskanzlei seines Vaters arbeitete er als leitender Redakteur einer Frauenzeitschrift, bevor er sich ab 1900 völlig der Literatur widmete. Eine Pressereise in die Vereinigten Staaten geriet zum Triumphzug und bescherte ihm endgültig literarischen Weltruhm, den Bennett mit über hundert Büchern für viele Jahre festigte.
Produktdetails
- Verlag: Eichborn
- Gesamtlaufzeit: 264 Min.
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783821853802
- Artikelnr.: 13234957
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.11.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.11.2003Gehe deinen Weg, aber halte den Mund
Lieblingsvision der Engländer: Arnold Bennetts "Hotel Grand Babylon" zeigt ein romantisches Deutschland der Lebkuchenburgen
Der neben Prousts "L'Affaire Lemoine" wichtigste und witzigste Parodienzyklus der modernen europäischen Literatur, Max Beerbohms "A Christmas Garland" (1912), führt neben Größen wie "H*nry J*m*s" (der von der Parodie begeistert war), "Th*m*s H*rdy" oder "G**rge B*rn*rd Sh*w" auch einen zumindest dem deutschen Leser kaum mehr bekannten "Arn*ld B*nn*tt" vor. Wer war Arnold Bennett, und was ist er heute? Beerbohms Parodie mit dem Dialekttitel "Scruts" gibt einen Hinweis: Er war - 1867 geboren - der Schilderer einer englischen Landschaft, des Industriegebiets
Lieblingsvision der Engländer: Arnold Bennetts "Hotel Grand Babylon" zeigt ein romantisches Deutschland der Lebkuchenburgen
Der neben Prousts "L'Affaire Lemoine" wichtigste und witzigste Parodienzyklus der modernen europäischen Literatur, Max Beerbohms "A Christmas Garland" (1912), führt neben Größen wie "H*nry J*m*s" (der von der Parodie begeistert war), "Th*m*s H*rdy" oder "G**rge B*rn*rd Sh*w" auch einen zumindest dem deutschen Leser kaum mehr bekannten "Arn*ld B*nn*tt" vor. Wer war Arnold Bennett, und was ist er heute? Beerbohms Parodie mit dem Dialekttitel "Scruts" gibt einen Hinweis: Er war - 1867 geboren - der Schilderer einer englischen Landschaft, des Industriegebiets
Mehr anzeigen
der "Five Towns" in Staffordshire. Diese romantisch-realistischen Schilderungen begründen noch am ehesten seinen Anspruch auf Fortdauer. Es steht hier umgekehrt wie bei H. G. Wells, dessen ernsthafte sozialkritische Romane vergessen sind und bleiben, während seine phantastischen Capriccios ("Die Zeitmaschine", "Der unsichtbare Mann") und komischen Romane ("Kipps", "The History of Mr. Polly") klassisch sind.
Bennetts leichtere Produktionen sind weitgehend verschollen. Eine davon wird nun auf deutsch vorgelegt. Es handelt sich nach Bennetts eigener Einteilung um eine "Fantasia", im Gegensatz zu den realistischen oder satirischen Romanen. In das Exemplar der Erstausgabe, das in der Berg Collection der New York Public Library aufbewahrt wird, hat der Autor den Satz eingetragen: "Go your own way and keep your mouth shut." Das suggeriert eine grimmige Eigenwilligkeit, die im Buch nicht unbedingt zu finden ist; originell aber dürfte man seinen Versuch durchaus nennen, und man kann sich damit gut unterhalten und die Strategie eines Experten studieren.
Bennett, der in einem langen Schriftstellerleben über achtzig Bücher schrieb, war ein zielbewußter Routinier. "The Grand Babylon Hotel: A Fantasia on Modern Themes" (1902) gehörte zu seiner Kampagne, sich als Schriftsteller unübersehbar durchzusetzen, und die Reiz- und Spannungselemente des Romans sind geschickt zusammengefügt. Das beginnt mit der Romantik des großen, mondänen Hotels (mit dem Babylon wird auf das Savoy angespielt), in dem sich vielfältig "die Schicksale kreuzen"; hierin ist Bennett ein Vorläufer von Vicki Baum, deren einst unerhört populärer Bestseller "Menschen im Hotel. Ein Kolportageroman mit Hintergründen" (1929) Idealtyp des Genres wurde.
Auf ein solches diffus-glamouröses Panorama, das bei Bennett mit ein wenig defensiver Ironie geschildert wird, wird ein Thema aufgeblendet, das wir dank Henry James eigentlich eher mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verbinden, das hier aber humoristisch gefärbt ist: die Amerikaner in Europa. Und zwar die reichen Amerikaner: der Protagonist Theodore Racksole ist vielfacher Millionär. Und als ihm der Service im Hotel Grand Babylon einmal nicht gefällt (man gibt ihm zu verstehen, daß es gewisse Dinge gibt, die man in Europa nicht bestellt), beschließt er kurzerhand, das gesamte Hotel zu kaufen.
Diese Konstruktion ist zunächst eine vergnügliche Allmachtsphantasie (à la "Drei Männer im Schnee") - werde ich nicht korrekt bedient, dann kaufe ich den Laden eben. Dann aber regiert die Romantik mit ihren unerschöpflichen Überraschungen und läßt die sinistren Agenten des Königs von Bosnien im Hotel aufmarschieren, wo beispielsweise der Küchenchef den unbequemen Leichnam eines ermordeten Doppelagenten kurzerhand einbalsamiert. Millionär und schöne Millionärstochter müssen dem gutaussehenden Prinzen Aribert von Posen helfen, die Verstrickung seines Großherzogs elegant aufzulösen.
Vielleicht ist es das Faszinierendste an diesem kleinen Roman, daß er uns einen kurzen Blick auf das phantasierte "Deutschland" jener Epoche gestattet, wie es sich für die Zwecke britischer Unterhaltungskonfektion darstellt, und daß dieses Deutschland etwas Hochromantisches ist. Bennett folgt damit einer bereits solide etablierten Topik. Der Klassiker dieses kleinen Genres ist der oft verfilmte, oft parodierte, einst hochberühmte Doppelroman "The Prisoner of Zenda"/"Rupert of Hentzau" von Anthony Hope (1894/1898). Das Zentralthema dieser Fiktion ist es, daß ein müßiggängerischer englischer junger Mann, der auf Grund der illegitimen Liaison eines Vorfahren im achtzehnten Jahrhundert einem kontinentalen Monarchen zum Verwechseln ähnlich sieht, sich bei einem Besuch in Ruritanien - dessen Hauptstadt man über Paris und Dresden erreicht - in eine wilde Intrige verwickelt sieht, die ihn nötigt, als Doppelgänger den König zu vertreten: um dem wahren Monarchen den Thron zu retten, den eine usurpatorische Fraktion ihm rauben will. "Ich würgte einen Kloß im Hals hinunter, rückte mir den Helm fest auf dem Kopf zurecht und (ich schäme mich nicht, es zu sagen) schickte ein kurzes Gebet zum Himmel. Dann betrat ich den Bahnsteig von Strelsau." Mit der Figur des Rudolf Rassendyll tritt für die englische Genreliteratur der deutsche Kleinstaatenfürst als Traumrolle neben den Detektiv, den Forschungsreisenden oder den Ritter (von welchem diese Tagtraumcharge viel hat). Dieses imaginäre "Ruritania" Hopes ist der Prototyp für eine Reihe deutsch-balkanisch-exotischer Szenarien; es wird in dem Marx-Brothers-Film "Duck Soup" von fern zitiert.
So ist auch bei Bennett Deutschland ein Hintergrund für Abenteuer, besser - da die eigentliche Intrige in London und Ostende stattfindet - das "Deutsche". Zunächst heißt das irgendwie Preußen mit seinem weiten Terrain und dem Pomp des Wilhelminismus. Aber es mischt sich noch etwas anderes hinein, was Chesterton einmal so benannt hat: "jener Eindruck von Kindlichkeit, welcher der schönste Zug an Deutschland ist - diese kleinen paternalistischen Zaubertheatermonarchien, in denen ein König so vertraulich-häuslich wirkt wie eine Köchin. Die Soldaten vor den unzähligen Schilderhäusern sahen seltsam wie deutsches Spielzeug aus, und die säuberlich gezinnten Schloßmauern, vom Sonnenuntergang vergoldet, wirkten eher wie eine überzuckerte Lebkuchenburg" ("The Fairy Tale of Father Brown"). Ein Roman wie dieser zeigt minutenlang etwas Seltsames: den linkischen Charme, den das Ausland gelegentlich beim Anblick des deutschen neunzehnten Jahrhunderts wahrnahm.
Daß hier der amerikanische Plutokrat, der sich von niemandem etwas gefallen läßt, und seine verwöhnte Tochter als Dei ex machina erscheinen, um eine dynastische Ehe zu arrangieren, ist eine nette Idee. Natürlich ist der Text zu einer Zeit entstanden, da das Problem solcher Alliancen, das heute immer noch die Klatschspalten beschäftigt, eine ungleich größere realpolitische Bedeutung besaß. Dementsprechend gut ist das Thema in der Unterhaltungsliteratur der Zeit auch vertreten. Ist nicht der illustre Klient der ersten Sherlock-Holmes-Kurzgeschichte kein anderer als "Wilhelm Gottsreich Sigismund von Ormstein, Großherzog von Kassel-Falstein und Erbkönig von Böhmen" - der kurz vor der Heirat mit "Clotilde Lothman von Sachsen-Meningen (sic!), zweiter Tochter des Königs von Skandinavien", steht und von einer Abenteurerin erpreßt wird? Der Titel der Erzählung, "A Scandal in Bohemia", erinnert unwiderstehlich an Shakespeares "sea-coast of Bohemia": Geographie (und exakte Genealogie) spielen keine Rolle, wenn die englische Literatur ihre potemkinsch-böhmischen Dörfer zimmert, aus deren Kulissenfenstern neurotische Großherzöge mit einem schwachen Zug um den Mund, Offiziere in phantastischen Uniformen und undurchdringlich lächelnde Kokotten sehen.
Dies ist ein kleines Werk eines Autors der unmittelbaren "Vormoderne", um aus Armin Eidherrs informativem Nachwort zu zitieren; Bennetts große Romane ("The Old Wives' Tale", 1908; "Clayhanger", 1910) wären möglicherweise auch einen Blick der Lektoren wert. Könnte man sie wiedererwecken? Bennett ist kein Autor des ersten Ranges, aber vielleicht gerade in seinem Scheitern ein unverächtlicher Künstler. Virginia Woolf notierte am 28. März 1931 ihre widersprüchlichen Empfindungen in ihr Tagebuch: "Arnold Bennett ist gestern gestorben, was mich trauriger macht, als ich gedacht hätte. Ein liebenswerter, echter Mensch; gehemmt, irgendwie ein wenig unbeholfen im Leben; wohlmeinend; gravitätisch; freundlich; plump; mit dem Bewußtsein, daß er plump war; vage & hilflos nach etwas anderem tastend ..., verblendet vom Glanz und Erfolg; aber naiv; ein alter Langweiler; ein Egoist; trotz all seinem Geschick dem Leben fast schutzlos ausgeliefert; Krämerperspektive auf die Literatur, aber doch mit den Anfangsgründen (überdeckt von Fett & Wohlstand & der Sehnsucht nach entsetzlichem Empire-Mobiliar) von Sensibilität. ... Ich wünschte eigentlich trotz allem, er würde mich weiter beschimpfen, und ich ihn."
Arnold Bennett: "Hotel Grand Babylon". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Renate Orth-Guttmann. Mit einem Nachwort von Armin Eidherr. Manesse Verlag, Zürich 2003. 385 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Bennetts leichtere Produktionen sind weitgehend verschollen. Eine davon wird nun auf deutsch vorgelegt. Es handelt sich nach Bennetts eigener Einteilung um eine "Fantasia", im Gegensatz zu den realistischen oder satirischen Romanen. In das Exemplar der Erstausgabe, das in der Berg Collection der New York Public Library aufbewahrt wird, hat der Autor den Satz eingetragen: "Go your own way and keep your mouth shut." Das suggeriert eine grimmige Eigenwilligkeit, die im Buch nicht unbedingt zu finden ist; originell aber dürfte man seinen Versuch durchaus nennen, und man kann sich damit gut unterhalten und die Strategie eines Experten studieren.
Bennett, der in einem langen Schriftstellerleben über achtzig Bücher schrieb, war ein zielbewußter Routinier. "The Grand Babylon Hotel: A Fantasia on Modern Themes" (1902) gehörte zu seiner Kampagne, sich als Schriftsteller unübersehbar durchzusetzen, und die Reiz- und Spannungselemente des Romans sind geschickt zusammengefügt. Das beginnt mit der Romantik des großen, mondänen Hotels (mit dem Babylon wird auf das Savoy angespielt), in dem sich vielfältig "die Schicksale kreuzen"; hierin ist Bennett ein Vorläufer von Vicki Baum, deren einst unerhört populärer Bestseller "Menschen im Hotel. Ein Kolportageroman mit Hintergründen" (1929) Idealtyp des Genres wurde.
Auf ein solches diffus-glamouröses Panorama, das bei Bennett mit ein wenig defensiver Ironie geschildert wird, wird ein Thema aufgeblendet, das wir dank Henry James eigentlich eher mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verbinden, das hier aber humoristisch gefärbt ist: die Amerikaner in Europa. Und zwar die reichen Amerikaner: der Protagonist Theodore Racksole ist vielfacher Millionär. Und als ihm der Service im Hotel Grand Babylon einmal nicht gefällt (man gibt ihm zu verstehen, daß es gewisse Dinge gibt, die man in Europa nicht bestellt), beschließt er kurzerhand, das gesamte Hotel zu kaufen.
Diese Konstruktion ist zunächst eine vergnügliche Allmachtsphantasie (à la "Drei Männer im Schnee") - werde ich nicht korrekt bedient, dann kaufe ich den Laden eben. Dann aber regiert die Romantik mit ihren unerschöpflichen Überraschungen und läßt die sinistren Agenten des Königs von Bosnien im Hotel aufmarschieren, wo beispielsweise der Küchenchef den unbequemen Leichnam eines ermordeten Doppelagenten kurzerhand einbalsamiert. Millionär und schöne Millionärstochter müssen dem gutaussehenden Prinzen Aribert von Posen helfen, die Verstrickung seines Großherzogs elegant aufzulösen.
Vielleicht ist es das Faszinierendste an diesem kleinen Roman, daß er uns einen kurzen Blick auf das phantasierte "Deutschland" jener Epoche gestattet, wie es sich für die Zwecke britischer Unterhaltungskonfektion darstellt, und daß dieses Deutschland etwas Hochromantisches ist. Bennett folgt damit einer bereits solide etablierten Topik. Der Klassiker dieses kleinen Genres ist der oft verfilmte, oft parodierte, einst hochberühmte Doppelroman "The Prisoner of Zenda"/"Rupert of Hentzau" von Anthony Hope (1894/1898). Das Zentralthema dieser Fiktion ist es, daß ein müßiggängerischer englischer junger Mann, der auf Grund der illegitimen Liaison eines Vorfahren im achtzehnten Jahrhundert einem kontinentalen Monarchen zum Verwechseln ähnlich sieht, sich bei einem Besuch in Ruritanien - dessen Hauptstadt man über Paris und Dresden erreicht - in eine wilde Intrige verwickelt sieht, die ihn nötigt, als Doppelgänger den König zu vertreten: um dem wahren Monarchen den Thron zu retten, den eine usurpatorische Fraktion ihm rauben will. "Ich würgte einen Kloß im Hals hinunter, rückte mir den Helm fest auf dem Kopf zurecht und (ich schäme mich nicht, es zu sagen) schickte ein kurzes Gebet zum Himmel. Dann betrat ich den Bahnsteig von Strelsau." Mit der Figur des Rudolf Rassendyll tritt für die englische Genreliteratur der deutsche Kleinstaatenfürst als Traumrolle neben den Detektiv, den Forschungsreisenden oder den Ritter (von welchem diese Tagtraumcharge viel hat). Dieses imaginäre "Ruritania" Hopes ist der Prototyp für eine Reihe deutsch-balkanisch-exotischer Szenarien; es wird in dem Marx-Brothers-Film "Duck Soup" von fern zitiert.
So ist auch bei Bennett Deutschland ein Hintergrund für Abenteuer, besser - da die eigentliche Intrige in London und Ostende stattfindet - das "Deutsche". Zunächst heißt das irgendwie Preußen mit seinem weiten Terrain und dem Pomp des Wilhelminismus. Aber es mischt sich noch etwas anderes hinein, was Chesterton einmal so benannt hat: "jener Eindruck von Kindlichkeit, welcher der schönste Zug an Deutschland ist - diese kleinen paternalistischen Zaubertheatermonarchien, in denen ein König so vertraulich-häuslich wirkt wie eine Köchin. Die Soldaten vor den unzähligen Schilderhäusern sahen seltsam wie deutsches Spielzeug aus, und die säuberlich gezinnten Schloßmauern, vom Sonnenuntergang vergoldet, wirkten eher wie eine überzuckerte Lebkuchenburg" ("The Fairy Tale of Father Brown"). Ein Roman wie dieser zeigt minutenlang etwas Seltsames: den linkischen Charme, den das Ausland gelegentlich beim Anblick des deutschen neunzehnten Jahrhunderts wahrnahm.
Daß hier der amerikanische Plutokrat, der sich von niemandem etwas gefallen läßt, und seine verwöhnte Tochter als Dei ex machina erscheinen, um eine dynastische Ehe zu arrangieren, ist eine nette Idee. Natürlich ist der Text zu einer Zeit entstanden, da das Problem solcher Alliancen, das heute immer noch die Klatschspalten beschäftigt, eine ungleich größere realpolitische Bedeutung besaß. Dementsprechend gut ist das Thema in der Unterhaltungsliteratur der Zeit auch vertreten. Ist nicht der illustre Klient der ersten Sherlock-Holmes-Kurzgeschichte kein anderer als "Wilhelm Gottsreich Sigismund von Ormstein, Großherzog von Kassel-Falstein und Erbkönig von Böhmen" - der kurz vor der Heirat mit "Clotilde Lothman von Sachsen-Meningen (sic!), zweiter Tochter des Königs von Skandinavien", steht und von einer Abenteurerin erpreßt wird? Der Titel der Erzählung, "A Scandal in Bohemia", erinnert unwiderstehlich an Shakespeares "sea-coast of Bohemia": Geographie (und exakte Genealogie) spielen keine Rolle, wenn die englische Literatur ihre potemkinsch-böhmischen Dörfer zimmert, aus deren Kulissenfenstern neurotische Großherzöge mit einem schwachen Zug um den Mund, Offiziere in phantastischen Uniformen und undurchdringlich lächelnde Kokotten sehen.
Dies ist ein kleines Werk eines Autors der unmittelbaren "Vormoderne", um aus Armin Eidherrs informativem Nachwort zu zitieren; Bennetts große Romane ("The Old Wives' Tale", 1908; "Clayhanger", 1910) wären möglicherweise auch einen Blick der Lektoren wert. Könnte man sie wiedererwecken? Bennett ist kein Autor des ersten Ranges, aber vielleicht gerade in seinem Scheitern ein unverächtlicher Künstler. Virginia Woolf notierte am 28. März 1931 ihre widersprüchlichen Empfindungen in ihr Tagebuch: "Arnold Bennett ist gestern gestorben, was mich trauriger macht, als ich gedacht hätte. Ein liebenswerter, echter Mensch; gehemmt, irgendwie ein wenig unbeholfen im Leben; wohlmeinend; gravitätisch; freundlich; plump; mit dem Bewußtsein, daß er plump war; vage & hilflos nach etwas anderem tastend ..., verblendet vom Glanz und Erfolg; aber naiv; ein alter Langweiler; ein Egoist; trotz all seinem Geschick dem Leben fast schutzlos ausgeliefert; Krämerperspektive auf die Literatur, aber doch mit den Anfangsgründen (überdeckt von Fett & Wohlstand & der Sehnsucht nach entsetzlichem Empire-Mobiliar) von Sensibilität. ... Ich wünschte eigentlich trotz allem, er würde mich weiter beschimpfen, und ich ihn."
Arnold Bennett: "Hotel Grand Babylon". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Renate Orth-Guttmann. Mit einem Nachwort von Armin Eidherr. Manesse Verlag, Zürich 2003. 385 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
»Ein gepfeffertes literarisches Amuse-Bouche.« NEUE ZÜRCHER ZEITUNG
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben