existentiellen Bezug zum eigenen Leben: "Er spürte, daß etwas bevorstand, er wußte, es würde etwas sein, das er nicht kannte."
Auf diesen ersten Seiten, die schildern, wie Kimmo Joentaa das Sterben seiner Frau erlebt, ist zu spüren, daß hier der Tod ernster genommen wird, als das oft in Kriminalromanen der Fall ist. Er ist hier nicht nur ein Mittel, die Handlung in Gang zu setzen, sondern zentrales Thema. Die weiteren Todesfälle in diesem Buch sind dann allerdings Morde: Zwei Frauen und ein Mann werden im Schlaf erstickt. In einem weiteren Fall, der der Polizei verborgen bleibt, scheitert der Versuch. Von Beginn an läßt Wagner den Leser diese Morde beobachten, ja sogar in die Gedanken- und Gefühlswelt des Serienmörders blicken. Nach einem knappen Drittel des Buches kennt man auch seinen Namen. Spannung muß also auf andere Weise erzeugt werden als durch die Frage nach dem Täter. Vielmehr geht es um das Duell zwischen Verbrecher und Ermittler, in dem dieser freilich nicht durch Kampf, sondern nur aufgrund von Einfühlung erfolgreich sein kann: Wandel durch Annäherung. In den überwiegend ruhigen Fluß des Erzählens fügt Wagner immer wieder Reihen meist kurzer Sätze ein, die allesamt mit "er" beginnen. Was, sparsam eingesetzt, ein wirkungsvolles Stilmittel sein könnte, erscheint in dieser Häufung als bloße Manier.
Für seinen ersten Roman "Nachtfahrt" hat Wagner den Marlowe-Preis der deutschen Raymond-Chandler-Gesellschaft erhalten, mit der Begründung, er habe die Genregrenzen erweitert. In "Eismond" fällt hingegen vor allem auf, wie kreativ der Autor gerade typische Elemente der Tradition zu nutzen versteht. Das gilt vor allem für den alten Grundsatz, daß Täter und Detektiv irgendeine gemeinsame Basis haben müssen: Miss Marple ermittelt nicht gegen die Mafia, und Humphrey Bogart mußte, als er von Gangster- zu Detektivrollen wechselte, weder an seinem Darstellungsstil noch an der Hutmode etwas verändern. Wagner geht hier allerdings ungewöhnlich weit, indem er den Polizisten Joentaa geradezu eine Art Seelenverwandtschaft mit dem psychopathischen Mörder entdecken läßt, die gemeinsame Besessenheit beider vom Thema Tod.
Die Genregrenzen des Krimis aber sind heute ohnehin schon äußerst weit gesteckt, und die Versuche allzu restriktiver Definitionen scheitern am Praxistest wie einst der berühmte Versuch Richard Alewyns, eine strikte Trennung der Begriffe "Kriminal-" und "Detektivroman" zu etablieren: Jener erzähle die Geschichte eines Verbrechens, dieser hingegen die Geschichte der Aufklärung eines Verbrechens. Heutzutage erzählen die meisten Romane beides. Die "offene Täterführung", so der Fachbegriff, ermöglicht dabei frühzeitige Einblicke in das Seelenleben und die Denkstruktur des Mörders. Genau darin liegt aber in diesem Roman auch ein Problem: So glaubwürdig Wagner die Darstellung von Joentaas Seelenzustand gelingt, so sehr sind Zweifel angebracht, wenn er das gleiche bei dem psychopathischen Serienkiller versucht. Hier scheint er sich - literarisch durchaus legitim - eher an poetischen als an psychologischen Gesichtspunkten zu orientieren und verwendet eine Fülle von Metaphern, die den Mond, Farben und immer wieder das Atmen betreffen: Der Mörder inhaliert Töne und Bilder, Angst und Macht. Eine Entsprechung gibt es beim Ermittler, jedoch in abgeschwächter Form: Statt zu inhalieren, atmet er nur ein. Wenn Wagner sagt, er interessiere sich für die Täterseelen, meint er wohl eher deren Ästhetisierung. Die Wahrscheinlichkeit bleibt dabei auf der Strecke.
Wagner, Anfang dreißig, ist im Hessischen zu Hause, jedoch mit einer Finnin verheiratet und kennt Finnland zweifellos gut. Dennoch ist die Vermutung vielleicht nicht völlig abwegig, daß sein neuer Roman auch deshalb in Nordeuropa spielt, weil in der näheren Umgebung der derzeitige Lieblingskommissar der deutschen Leserschaft, der Schwede Kurt Wallander, ermittelt. Um die Verkaufszahlen eines Henning Mankell zu erreichen, hätte Wagner jedoch vermutlich noch einen Schritt weitergehen und sich etwa Janne Kontti Vaagnäärinen nennen müssen. Denn die Deutschen pflegen bestsellerwürdige Krimiautoren überall zu suchen, nur nicht im eigenen Land.
HARDY REICH
Jan Costin Wagner: "Eismond". Roman. Verlag Eichborn. Berlin, Berlin 2003. 308 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main




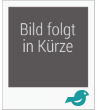

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.10.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.10.2003