sprachlicher Musikalität.
Die titelgebende Inszenierung findet statt in einem Krankenhaus, das Krankenzimmer ist die Bühne, der Drahtzieher des Stücks ist der Regisseur Augustus Baum, zusammengebrochen während der Proben zu Tschechows Komödie "Die Möwe". Aber schon singt und jubiliert er wieder. Denn er ist verliebt. In Ute, die er Marie nennt, seine Nachtschwester. Wer tauft, ist schon der Schöpfer eines Stücks. Und was Augustus Baum aufführt, ist kein Regie-, sondern ein Liebestheater mit den Mitteln der Literatur.
Schein, Sein, Kunst, Leben, bei Martin Walser geht eins ins andere über, wieder einmal ist nichts ohne sein Gegenteil wahr. Und klugerweise tut er gar nicht so, als sei diese Durchlässigkeit irgendwie neu. Walser liebt es, den Großen zu huldigen. Dieses Mal heißt sein Meister Anton Tschechow. Das Meisterstück "Die Möwe".
Schon dort schreibt Trigorin, der Dichter, wie jetzt Augustus, mal eben einen gerade gehörten Satz ins Notizbuch zur literarischen Verwendung. Da werden Zitate zur Verständigung benutzt, das Spielen von Szenen dient zur realen Annäherung und umgekehrt. "Die beiden sind ineinander verliebt, und heute werden ihre Seelen verschmelzen im gemeinsamen Kunstwerk", heißt es 1895 und passt auch für 2013. Die Welt sei eine Bühne, eine Inszenierung, sagt Augustus mit Shakespeare.
Aber wer zieht die Strippen? Der Regisseur, der selbst die Rolle des Regisseurs spielt? Steht er auf oder neben der Bühne? Im Roman gibt es zwei Wege, das zu klären: den romantischen und den vernünftigen, das sich überbietende Spiel oder die eindeutige Entscheidung. Dahinter steckt eine Machtfrage. Wie fast jeder Walser-Held ist Augustus verheiratet. Seine Ehefrau heißt Gerda und ist Psychologin. Sie kennt ihren Augustus, dessen Lieblingszahl die Drei ist. Sein Traum: Augustus, Ute-Marie UND Gerda. Offen, ohne Betrug. Die Trinität der Liebe. Aber Gerdas neues Buch heißt "Abhängigkeit, Wahn, Wirklichkeit", ein Kapitel: Schweigen und Verschweigen, ein anderes: Verheimlichung und Geheimhaltung.
In Walsers Roman sind die Männer die Romantiker, die Risikospieler. Sie besingen Frauen, trällern Liebesarien. Der Walser-Mann liebt nicht nur zwei Frauen zugleich, sondern glaubt, sie wären darüber entzückt. "Ich liebe mehr, als ich je lieben könnte. Ich liebe dich, und ich liebe die Nachtschwester. Das ist ein Gefühl ... der Umarmungsstärke." Frauen dagegen sorgen für Ordnung. Nur aus der Perspektive der Männer scheinen sie Heilige und Hure, fürs Frühstück sorgende Ehefrau und liebestolle Nachtschwester. In Wirklichkeit sind sie allesamt zurechnungsfähig. Niemals scheint der Graben zwischen Männern und Frauen bei Martin Walser tiefer als im neuen Buch.
In Tschechows "Möwe" gibt es eine ähnliche Konstellation. Die fragile Nachwuchsschauspielerin Nina verliebt sich in den erfolgreichen Dichter Trigorin, der mit dem alternden Bühnenstar Irina Arkadina verbandelt ist. Trigorin fordert von Arkadina sein Unabhängigkeit zurück, um für Nina frei zu sein. Doch vor der ganzen "Gestik der besitzergreifenden, machtausübenden Verzweiflung" der Verlassenen kapituliert er. Er unterwirft sich. Und daran wird auch die anschließende Affäre mit Nina nichts ändern. Arkadina hält die Fäden in der Hand. In einer unwiderstehlichen Analyse dieser Szene spannt Augustus Tschechow für seine Zwecke ein. Betrug verödet die Liebe. Arme Männer.
Und plötzlich kommt ein Brief aus Amerika, wie schon bei Tschechow. Walser liefert das theoretische Rüstzeug für den Roman gleich mit. Auch das ist typisch. Wieder geht es um eine Dreierkonstellation, wieder geht es um Betrug. Augustus heißt jetzt Hans Georg, Gerda Ursula und Ute-Marie Bertie. Wie Augustus war Hans Georg "bis zur Erschöpfung im Frauendienst tätig". Aber eben nicht nur. Der angebliche Schach-Club war ein Schwulentreff. Ursula ist entsetzt. Der Entlarvte flieht, verfolgt von der "Moral-Industrie" der betrogenen Ehefrauen nach Amerika und nimmt eine College-Stelle an. Sein Thema: Platon, der Philosoph der direkten Rede. Platon, das ist Philosophie auf der Bühne, Denken im Dialog, so eng hängen Philosophie und Theater zusammen.
Kurz winkt Martin Walser hier seinem letzten Roman "Das dreizehnte Kapitel" zu, der Theologe Karl Barth habe auch mit Paulus gesprochen, nicht über ihn. Aber ein fundamentaler Unterschied bleibt: Während sich Walser im "Dreizehnten Kapitel" die Sprache der Liebe von der Theologie leiht, von den literarisch talentiertesten Vertretern der Gottessuche, profitiert in der "Inszenierung" der liebesselige Augustus von der Literatur selbst. Das hat entscheidende Folgen. Hymnen, Gebet, Gotteslob - die Liebe zu Gott findet vollständig mit und in der Sprache statt, wenn zwei sich darüber verständigen, dann gibt es keinen Sex zwischen ihnen und darum im "Dreizehnten Kapitel" keine Affäre. Die Sprache der Literatur dagegen ist Verführung. Literatur will Liebe. Sie spricht mit Menschen, nicht zu Gott.
Währenddessen laufen dem Theaterregisseur Augustus die Schauspieler davon. Egal. Längst plant er "Die Möwe" als Zwei-Personen-Stück, er als Trigorin, Ute-Marie als Nina. Aber die hat ihre eigenen Pläne. Selbst die Geliebte reiht sich ein in die Phalanx der vernünftigen Frauen und entscheidet sich für ihren Mann Andreas, den sie Vinze nennt! Dass auch andere inszenieren, das war in Augustus' Inszenierungen nicht vorgesehen. Also allein Sein Monolog heißt: "Ich klage an vor dem Gerichtshof der Liebe. Erster und einziger Anklagepunkt: Herrschsucht. Ihr, Dr. Gerda und Ute-Marie, ihr seid, so verschieden ihr sein mögt, ein Herz und eine Seele. Wenn es um den Mann geht. Ihr verlangt seine Unterwerfung. (...) Unabhängigkeit. Das ist die letzte Utopie!"
Und noch einmal zieht Walser alle Register der Engführung. Bei Tschechow erschießt sich der unglückliche Konstantin, der es weder zum Schriftsteller noch zum Liebhaber gebracht hat, hinter der Szene. Der Regisseur Augustus wiederum überlegt, ihn auf der Bühne in die Luft schießen zu lassen mit den Worten: "Konstantin Gawrilowitsch hat sich erschossen." Daran hält sich der Schauspieler Augustus zum Höhepunkt seiner Anklage. "Augustus hat sich erschossen", lauten seine letzten Worte. Ein unmöglicher, paradoxer Sprechakt, der nur eines bedeutet: Das Leben geht weiter - irgendwie. Aus dem Tschechowschen Unglück wird die Kippfigur eines Walserschen Unglücksglücks.
"Dass du nur deinen Text hast, nur deinen Text sagen kannst und weißt: Es bringt überhaupt nichts", das macht nach Augustus die Komödie aus. Diese Definition passt auf den Roman. Handlung spielt keine Rolle oder ist vergangen. Kein Wort führt zu etwas. Das körperlich Entscheidende ist schon geschehen. Der GV, wie es im Text heißt, liegt vor dem Roman. Im Roman wird nur gesprochen. Der ist darum postkoital, wenn alle Tiere traurig sind. Also lesen wir: eine traurige Komödie.
"Das dreizehnte Kapitel" war eine Tragödie. Die Walsersche Trias, ein Mann liebt zwei Frauen, endete tödlich. Doch Komödien wie "Die Inszenierung" haben ebenfalls kein Happy End. Alle Paare sind verloren, die Ehen kaputt. So lässt Walser auch noch die Beziehung von Ute und Vinze scheitern. Alle sind einsam. Die Verschwörung der Vernünftigen macht keinen glücklich. Darum bleibt Augustus das letzte Wort: Badenweiler. Da, wo Tschechow gestorben ist.
FRANK HERTWECK
Martin Walser: "Die Inszenierung".
Rowohlt Verlag, Reinbek 2013. 176 S., geb., 18,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






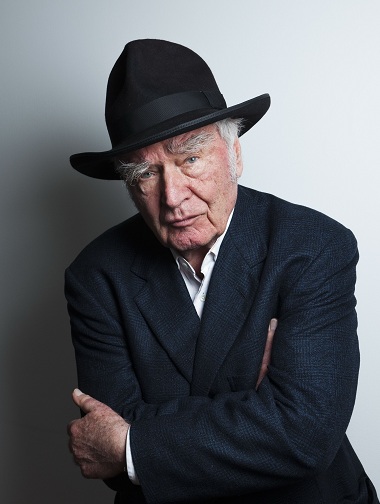
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.08.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.08.2013