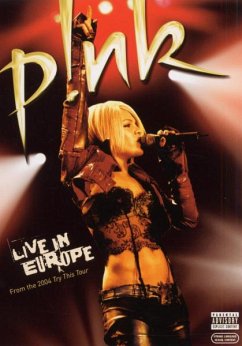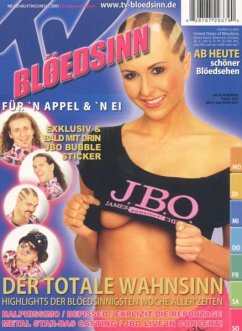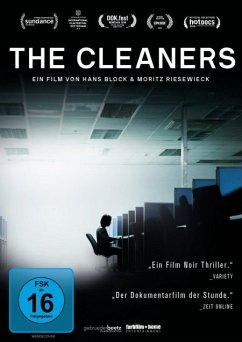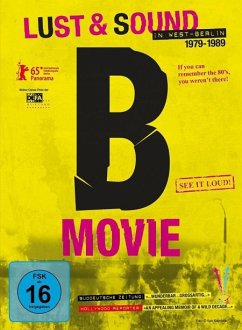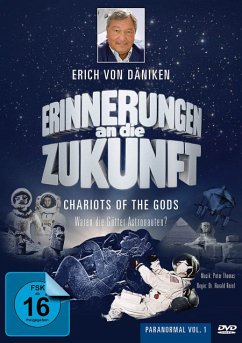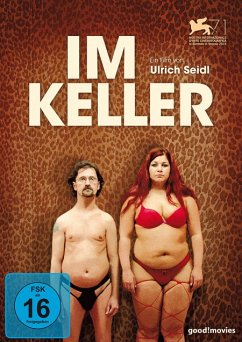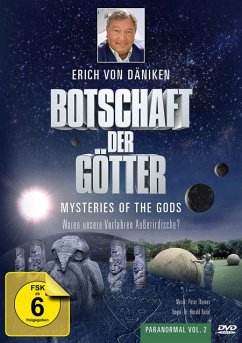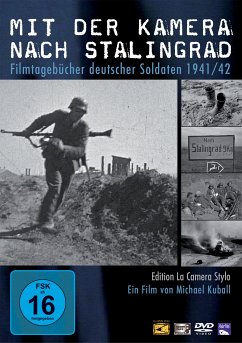trägt, von Punkermädchen aufgefordert, die schwarzrotgoldenen Aufnäher von den Ärmeln zu rupfen: Die Jacke sei ja schick, die Fahne nicht. Von wegen schwarz-rot-geil. Die "Bild"-Zeitung hat diesen ihren Lieblingskalauer schon seit Wochen nicht mehr auf dem Titel gehabt, und wenn man überhaupt noch mal irgendwo eine von den Aldi-Deutschlandfahnen dieses Sommers sieht, dann baumelt sie schlapp im Hintergrund vom Sozialwohnungsbalkon, wenn "Brisant" von jungen Muttis berichtet, die ihre Babys in den Müll geworfen haben.
So sieht das, euphoriebereinigt, aus in Deutschland Ende 2006. Vermutlich ist das die Depression, die zu erwarten war nach der großen patriotischen Handentspannung. Und eigentlich müßte man über all das gar nicht reden, wenn es nicht doch ein paar Dinge zu bestaunen gäbe, die jetzt sozusagen den kulturellen Mehrwert dieses patriotischen Sommers abschöpfen.
Zu bewundern sind und gelobt werden sollen hier im folgenden: die Ausstellung "This Land is My Land" in der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst sowie im Künstlerhaus Bethanien Berlin, das neue Laibach-Album "Volk" sowie die unter dem Titel "Völkerball" veröffentlichten Weihnachtsgaben für die Fans der Gruppe Rammstein. Was diese drei Dinge verbindet, die sauber linksradikal argumentierende Kunstausstellung, den populären Breitwandrock von Rammstein und schließlich das slowenische Krachkunstkollektiv Laibach, von dem sogar ein Denker wie Slavoj Zizek dauernd den Eindruck zu erwecken versucht, er habe mal dazugehört oder zumindest backstage gedurft: Das ist die Tatsache, daß es bei allen noch einmal um so nebulöse, tabuumwölkte und daher spannende Sachen wie das Volk und die Nation gehen darf, während alle, die was auf sich und die Postmoderne halten, nur noch vorsichtig von "Multituden" sprechen, wenn es um Menschenkollektive geht.
Die Ausstellung "This Land is My Land" zum Beispiel bezieht im Moment noch einmal einen deutlichen Zuwachs an Brisanz dadurch, daß sie nur einen Pflastersteinwurf weit vom Kreuzberger Wrangelkiez stattfindet, wo soeben die gleichnamigen "Krawalle" für Aufregung in den integrationspolitischen Debatten gesorgt haben. Konzipiert wurde sie aber schon für diesen Frühsommer, als jeden Tag ein neues Plädoyer für einen neuen entspannten Patriotismus in die Buchgeschäfte kam, jeder "Dtschlaaand"-Gesang mit einem lobenden Leitartikel bedacht wurde und noch wichtiger als der Torjubel die Frage war, wie "das Ausland", das ja sonst nichts zu tun hat, eigentlich über den deutschen Torjubel denkt.
Wenn irgendwer gedacht hat, daß man wenigstens den sogenannten Verfassungspatriotismus mit ein bißchen Begeisterung ausleben dürfe, dann muß er in diese Ausstellung gehen, um ordentlich eine vor den Bug zu kriegen: "Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich", nörgelt da Thomas Locher in seiner großen Wandinstallation zum Grundgesetz: Was heißt da bitte "alle", was heißt "gleich", und warum überhaupt. Und so wie diese Arbeit den Text zerpflückt und, wie Kuratoren gern sagen, "hinterfragt", hält es die Ausstellung insgesamt mit dem Mythos von Volk und Nation und beharrt im Moment der größten Wirgefühlsduseligkeit ordnungsgemäß spaßbremsenhaft darauf, daß Nationen ohnehin nur "hybride Gebilde" seien und überhaupt viel mehr von den Außenseitern, namentlich den Migranten geredet werden müsse. Also ist viel von Türken und von Ostdeutschen die Rede und davon, wie diese beiden Minderheiten ihren Platz in diesem Land suchen und sehen. Und am besten ist das naturgemäß immer dann, wenn die Betroffenen selber zu Wort kommen, weshalb es in dieser Ausstellung kaum bedeutende Kunstwerke, dafür aber sehr viele umwerfende Dokumentarfilme zu besichtigen gibt, zum Beispiel den von kolumbianischen Bürgerkriegsflüchtlingen, die es ins selber hinreichend depressive Lauchhammer nach Südbrandenburg verschlagen hat. Ein anderer, fast noch interessanterer Aspekt dieser Ausstellung bezieht sich auf das "Nation Branding", auf die gewissermaßen marketingtechnischen Mechanismen des neuen Patriotismus sowie auf den Umstand, daß der sogenannte Standort Deutschland immer ausgerechnet von denen am schlechtesten geredet wird, die ihn nachher mit ihrer Euphorie retten wollen. "Dem Krankheitsbild versucht man mit positivem Denken im Stil neurolinguistischer Programmierung entgegenzutreten und Events zu lancieren, die positive Gemeinschaftserlebnisse fördern", heißt es dazu im Katalog, und Jun Yang erläutert in einer Videoinstallation überzeugend, warum sein Heimatland China auf seinem Weg zur Supermacht zwingend Olympische Spiele, bewundernswerte Helden sowie einen Medaillenspiegel benötige, wie er schließlich schon der kleinen DDR internationale Anerkennung eingebracht hat.
Dort, im Osten, hat überhaupt vieles seine Wurzeln, was aktuell als unheimlich gilt: Die FDJ-artige "Du bist Deutschland"-Kampagne, die Bundeskanzlerin und auch die Rockgruppe Rammstein. Rammstein, da können die Popintellektuellen dieses Landes ihre Brillen zerbeißen vor Wut, ist nun einmal die weltweit erfolgreichste Band Deutschlands, und dem üppigen Weihnachtspaket, das sie jetzt unter dem Titel "Völkerball" und dem Logo der Olympischen Sommerspiele von Moskau in die Läden gestellt haben (Live-CD, Live-DVD, Fotobuch, Dokumentationen) ist vor allem zu entnehmen, wie erstaunt die Band selber darüber ist, daß die ganze Welt so darauf abfährt, wenn sie das teutonische Rumpelstilzchen geben. In Rußland, wo alte Mütterchen bei Rammstein-Konzerten den Text im Booklet mitlesen, sei er sich vorgekommen, als hätte das Goethe-Institut 7000 Leute zum Deutschkurs mit Musik geschickt, erzählt da Rammstein-Manager Emanuel Fialik, und in Mexiko kämen die Leute mit Nietzsche-Büchern, Strauß-Partituren und Luther-Bibeln zur Autogrammstunde. In Guadalajara haben sie im Radio sogar durchsagen lassen müssen, daß es gewiß nett gemeint sei, die Band aber trotzdem nicht freue, wenn die Leute mit Hakenkreuzen zum Konzert erschienen. Dazu muß man vielleicht erwähnen, daß Fialik, der Mann, der bei Rammstein am unverblümtesten über die "Gleichschaltung der Gefühle" redet, jeden Nazi-Verdacht spielend mit seiner dunklen Hautfarbe widerlegen kann und daß die Lederhosen und die Gamsbarthüte aus der Rammstein-Bühnengarderobe in Berlin und Schwerin, wo die Mitglieder der Band herkommen, nicht weniger exotisch sind als zum Beispiel in Malawi. Aber solange die Welt meint, das Bayerische für das Deutsche halten zu müssen, sind die Lederhosen völlig logisch, denn wenn man Rammstein eines ganz gewiß nicht vorwerfen kann, dann ist das Zaghaftigkeit bei der effektivstmöglichen Ausbeutung noch der ausgenudelsten Nationalklischees: Maschinenmenschentum, "Romantik", Trachten, Marschmusik. Wenn derartige Dinge erst einmal zu Rock-'n'-Roll-Requisiten geworden sind, ist man ja eigentlich aus dem Gröbsten raus, und das erfreulichste an der neuen Volklore in den Künsten ist die Tatsache, daß das Nationale so komplett volatil, allgemein verfügbar, um nicht zu sagen: wurzellos geworden ist.
So kommt es, daß von Laibach jetzt eine sehr großartige Platte mit Nationalhymnen vorliegt. "Einikhkait und Rekht und Frai'hait" zum Beispiel ist, so als slawischer Trauergesang vorgetragen, noch einmal ein Grund mehr, beim "Lied der Deutschen" aufzustehen und das Haupt zu senken. Diese Platte klingt so, als sei sie ein großes und schwerwiegendes Kunstwerk, wie Laibach überhaupt bei der Analyse von und dem Spiel mit tabuisiertem Nationalgedöns ungefähr auf halbem Weg zwischen Rammstein und Kunstverein liegt.
Prinzipiell ist es ja auch in den Patriotismus-, Leitkultur- und Integrationsdebatten so, daß gewisse Behauptungen nur fallen, weil sie auf der Stelle in der Luft zerrissen werden. So ist etwa Matthias Matusseks unbekümmertes Patriotismus-Pamphlet nur als Reaktion auf die kritische Übellaunigkeit zu begreifen, wie sie zum Beispiel in der Kreuzberger Ausstellung waltet - und umgekehrt. Das eine wäre ohne das andere weder erklärlich noch erträglich. Letztlich ist das Thema ein bewundernswerter Beschäftigungsgenerator. Und wie sich hier zwischen These, Antithese und synthetischer Musik die Dinge im Weihnachtsgeschäft emporhegeln: Das ist schon fast ein Grund zum Jubeln, ganz entspannt, versteht sich.
PETER RICHTER
Laibach: "Volk", Mute Records, ca. 18 Euro. Rammstein: "Völkerball", Universal, ca. 25 Euro, die Limited Edition mit Bildband ca. 110 Euro. "This Land is My Land" bis 3. Dezember, Katalog 12 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
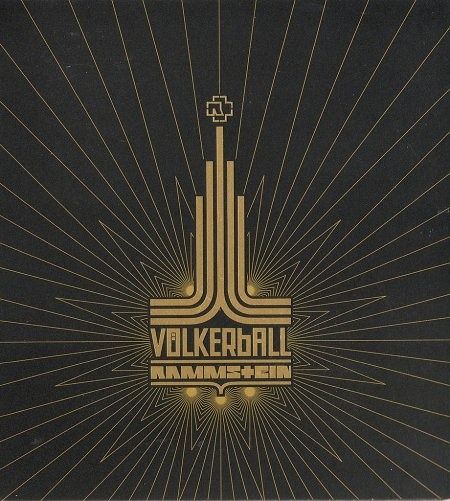





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.11.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.11.2006