zwischen zwei Roboterrassen rumpelt, nämlich den aufrechten Autobots und den abgefeimten Decepticons - Näheres unter "Transformers" im Internet. Charlie birst vor Charme, den die zweiundzwanzigjährige Hailee Steinfeld in tausend T-Shirts und beschossen von allen Actiongefahren versprüht, bis man begreift: Dieses Mädchen ist der Hammer. Der Autobot, den Charlie "Bumblebee" tauft, ist der passende Amboss dazu, getarnt als knallgelber VW Käfer. Die stahlharte und doch geschmeidige Liebe zueinander, die diese beiden gemeinsam schmieden, ist langmütig und freundlich, eifert nicht, treibt nicht Mutwillen, bläht sich nicht auf, verhält sich nicht ungehörig, sucht nicht das ihre, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht zu, freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, freut sich aber an der Wahrheit und erblüht im Film zum ersten Mal zu "Higher Love" von Steve Winwood, damit das Publikum schnallt: Wenn dies hier kein Weihnachtsfilm ist, gibt es dieses Jahr weder Weihnachten noch Filme.
"Shape of Water" für die Waschstraße, Romeo und Julia an der Leitplanke: Während Edward Furlong 1991 in "Terminator 2: Judgment Day" und Thomas Dekker zwischen 2008 und 2009 in "Terminator: The Sarah Connor Chronicles" noch ihr Genüge daran hatten, eine anthropomorphe Kampfmaschine zu Bubenstreichen zu animieren ("Mein eigener Terminator!"), bastelt Charlie an ihrer Hummel vor allem herum - das Verb im Englischen dazu heißt "to tinker", was zwar immer mit "basteln" übersetzt wird, wobei man aber ans Seidenpapierfalten oder ans textile Werken denkt, während ein Tinkerer eine Person ist, die sich mit Feinmechanik auskennt (wie die Fee "Tinkerbell" aus Disneys "Peter Pan"-Komplex, vor allem seit man sie für computergenierte Trickfilme wiederbelebt hat). Charlie, das Ingenieurgör, steht für einen, na, sagen wir: Karosseriemodellwechsel innerhalb der "Transformer"-Filmreihe: Nach dreieinhalb Parkhäusern voller Krachschinken, deren jeder pompöser, blöder und öder war als alle vorherigen, die aber ungefähr blechzig Idiotillionen Dollar eingespielt haben, will man jetzt zu den Ursprüngen zurück, das heißt: zu der Sorte unmittelbar kinderherzfrequenztreibender Geschichten, mit der man in den achtziger Jahren erstmals anfing, Spielzeug zu verkaufen, das Helikoptern, Rennautos, Düsenjägern oder Panzern glich, die man zu klobigen Robotern umbauen konnte und vice versa. Der Zeitraum, in dem "Bumblebee" spielt, lässt sich leicht ahnen: Ronald Reagans Porträt hängt noch in amerikanischen Amtsstuben, jede Woche kobolzt der Außerirdische Alf durch die Glotze, und The Smiths klingen noch frisch (wenn auch bereits so scheußlich wie alles, woran ihr Sänger Morrissey seither beteiligt war).
Menschen, die mal wieder (oder auch erstmals) Bon Jovis "Runaway", die "Cheers"-Titelmusik oder Synthesizergemüse von Howard Jones hören wollen, vieles davon sogar als Plot-Element (Bumblebee kommunziert mittels Radioschnipseln), werden im Kino vor Freude zu Bandsalat zergehen. Alle anderen müssen nur wissen: "Bumblebee" ist ein Film, in den pensionierte Videorecorder mit ihren Computerenkeln gehen können, um ihnen hinterher zu erklären: So wie hier war's damals zwar nicht. Aber so wäre es gewesen, wenn gälte, was überholte Technik und Humanität in Rente immer träumen: Früher war alles besser.
DIETMAR DATH
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
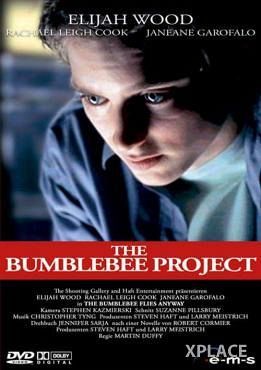





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.12.2018
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.12.2018