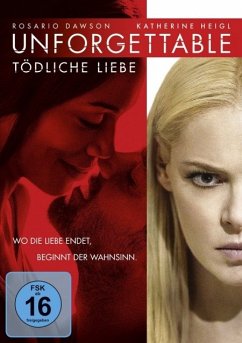Maschine Hollywood für junge Talente bereithält, ihr nur allzu gut bekannt. Als sie also im Jahr 2002 beim Dreh von David Finchers "Panic Room" auf Kristen Stewart traf, erkannte sie in ihr schnell das Ausnahmetalent.
Stewart, die im Film Fosters Teenager-Tochter spielt, feierte während der Dreharbeiten ihren elften Geburtstag. Im Film wirkt sie älter, spielt mit der Selbstsicherheit einer Erwachsenen, und das ist als Gegenüber von Foster keine leichte Aufgabe. Der Inhalt des Films ist schnell erzählt: Mutter und Tochter ziehen nach der Scheidung in eine große Stadtvilla in Manhattan, der Kauf soll zulasten des Ex-Manns gehen, der mit seiner Geliebten wenige Blöcke entfernt wohnt. Vorbesitzer der Villa war ein reicher Exzentriker, der sich im Schlafzimmer einen gepanzerten Sicherheitsraum einrichten ließ, der ihn vor Einbrechern schützen sollte. Völlig übertrieben, findet die Mutter. Doch dann verschaffen sich gleich in der ersten Nacht im neuen Heim Einbrecher Zutritt zum Haus, weil sie hier verstecktes Erbe vermuten. Also flüchten die beiden Frauen in den Sicherheitsraum, nur um festzustellen, dass dies der Ort ist, an den auch die Einbrecher wollen.
Was recht simpel klingt, ist kunstvoll gebaut: Da sind zum einen die vielen Einfälle, mit denen Fincher das Haus in Szene setzt. Man muss von der ersten Minute an aufmerksam hinsehen, denn schon bei der Hausbesichtigung erklärt der Makler den Grundriss der drei Stockwerke, auf denen sich das Drama später abspielen wird.
Während die Einbrecher dann des Nachts ins Haus zu gelangen versuchen, fährt die Kamera aus ungewöhnlichsten Blickwinkeln den Lageplan ab, fliegt vom Gerüttel an der Eingangstür über die Oberflächen von Küchentischen, Stühlen, Kommoden, durch Regale hindurch zur Hintertür, wo der zweite Einbrecherkomplize schon wartet. Durch Dielen und Decken hindurch folgt der Blick dann dem Komplizen beim Klettern aufs Dach, legt dabei gleich den Querschnitt der Zwischenräume der Stockwerke frei, die die Einbrecher später zu durchdringen versuchen werden. Durch diese wilden Kamerafahrten wächst die Spannung. Der Blick, der hier fast aus der Sicht der Hauses eingenommen wird, das sich gegen die Eindringlinge mit jeder verschlossenen Tür zu wehren versucht, vermittelt Beklemmung, steigert ständig stufenlos das, was Hitchcock in seinen Filmen als "Suspense", also Spannungsbogen, perfektioniert hat.
Noch kunstvoller als diese technischen Aspekte aber ist das Spiel zwischen Foster und Stewart. Foster ist für kühle Präzision bekannt, legt ihre Rollen lieber zurückhaltend und gerade deshalb besonders effektiv und authentisch an. Stewart gleicht sich dem an, durchdringt ihre Tochterfigur instinktiv so, dass sie mit ähnlichem Understatement arbeitet. Hier wird nicht geschrien, hier werden keine Vorwürfe erhoben. In dem stillen Einvernehmen zwischen den beiden Frauen, die die Situation so gut wie möglich zu meistern versuchen, schwingt die stille Übereinkunft über die neue Familiensituation mit. Fincher zeigt lieber, als mit großen Worten zu erzählen. Und selbst kleine Humorsplitter weiß Stewart pointiert auszuspielen: Wenn die Mutter die Tochter fragt, wo sie das Morsen gelernt hat, als diese versucht, mit einer Taschenlampe durch den Lüftungsschacht Hilfe zu rufen, antwortet sie trocken: "Titanic." Stewart gelingt es, solche adoleszenten Selbstbehauptungsgesten so zu verpacken, dass ihre Figur nie arrogant, nie nervig wird. Und sie bleibt auch dann absolut präsent, wenn die Tochter, die sie spielt, langsam in Panik abrutscht, weil sie diabeteskrank ist und auf einen Zuckerschock zusteuert.
Foster erkannte und stimulierte bei der Arbeit mit Stewart Begabung und Sensibilität der jungen Kollegin. Da sie wusste, dass die Zeiten für Jungdarsteller mit Paparazzi-Übergriffen und dem Internet noch härter geworden waren, versuchte sie, ihr von einer Schauspielkarriere abzuraten.
Doch Stewart ließ sich, zum Glück, nicht davon abbringen. Die Hartnäckigkeit zahlte sich aus, sie hat sich erst mit der "Twilight"-Vampirjugendreihe einen Namen gemacht, um dann mit großen Arthouse-Regisseuren wie Olivier Assayas, Pablo Larraín und Woody Allen zu arbeiten, sie war für ihre Rolle als Lady Di in "Spencer" für den Oscar nominiert und ist mit nur 32 Jahren seit diesem Donnerstag die jüngste Jurypräsidentin der Berlinale - all das ist allemal einen Blick auf ihren Karrierebeginn wert. MARIA WIESNER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main












 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.02.2023
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.02.2023