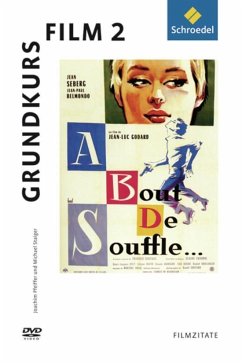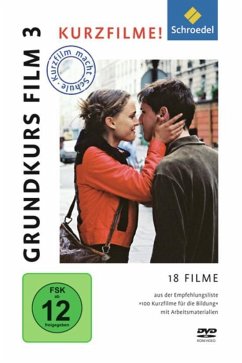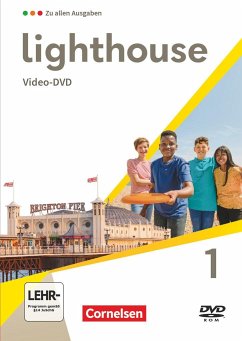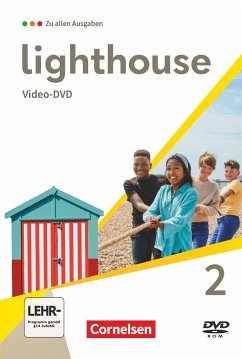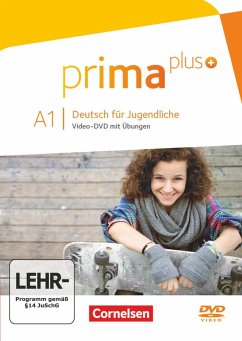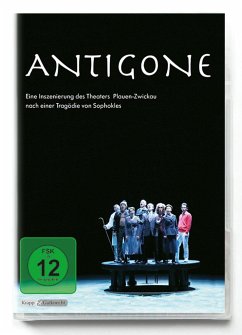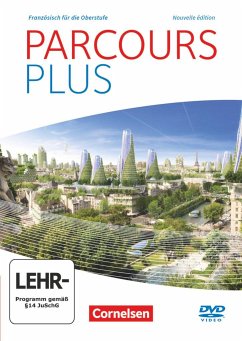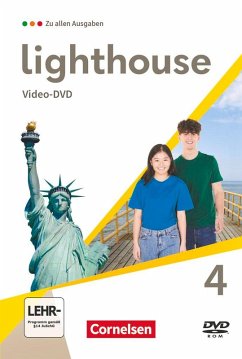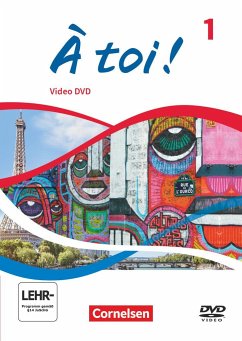besitzen. 2008 ausgerechnet, im Jahr der großen Wirtschaftskrise, als die Angst ums Geld die Angst um die sogenannte deutsche Leitkultur überholte. Immerhin sieben Jahre, bevor man staunend am Münchner Bahnhof stand, die Plakate sah und die müden Gesichter und das Wort Erstaufnahmeeinrichtung lernte.
Man wollte diesen Film lieben, weil Clint Eastwood in ihm der leidende, verirrte King Lear ist, der früher als Soldat im Koreakrieg kämpfte und später als Arbeiter in der Ford-Fabrik in Detroit schuftete. Ein Kerl, dem gerade die Frau weggestorben ist und dessen Söhne opportunistische Nichtsnutze sind und der den Typus des mürrischen alten weißen Mannes mit dem größtmöglichen tragischen Potential ausfüllt. Man wollte ihn lieben, und so kam es.
Es war ja auch ein Märchen. Es handelte davon, wie eine südostasiatische Großfamilie vom Volk der Hmong am verlassenen Stadtrand von Detroit, wo die Häuser nach dem Ende des durch und durch weißen automobilen Reichtums vor sich hin rotten oder von Einwanderern bewohnt werden, erst Ärger mit ihrem rassistischen Nachbarn, eben diesem Walt hat, dann aber in ihm einen Rächer der Entrechteten, einen Freund für den jungen Thao und einen Streiter für Gerechtigkeit findet. Der, als er sieht, wie die Tochter der Familie mit ihrem hasenfüßigen Freund von einer der die Stadt belagernden Gangs angepöbelt wird, seine Hand hebt und mit seinem Finger auf sie zielt (bang) - und wie diese Geste von ihm reicht, um sie loszuwerden. Aber eben nur vorläufig in dieser Stadt der Gefallenen, der Hoffnungslosen, der Unbeschäftigten und arbeitslosen Arbeiter, wo die Scherben der Vergangenheit auf der Straße herumliegen.
Der Moment der Erlösung, den der schwerkranke Walt am Ende von "Gran Torino" anbietet, hat 2008 trotzdem funktioniert. Er bringt ein Opfer, das sich nur für die lohnt, die zurückbleiben. "Your world is nothing more than / All the tiny things you've left behind", singt Jamie Cullum.
Heute ist es schwerer, sich der Vorstellung dieses Märchens hinzugeben, beständig brechen die Gedanken an die amerikanische Wirklichkeit in das abermalige Anschauen dieses Films herein: die Vorwahlen in Iowa. Incels, Alt-Right, Q-Schamanen. Und damit drängt sich die Frage auf: Gibt es solche Walts noch?
Leute, die verbohrt und engstirnig sind, aber niemals Fox News schauen würden. Einsame, allein auf sich selbst vertrauende Sonderlinge mit Waffenschein und ausgeprägtem Ehrgefühl, die in ihren Wohnzimmern Ressentiments nähren, sich aber nie von ihnen auf die Idee bringen ließen, an der staatlichen Ordnung zu rütteln.
Lieber frisst so ein Walt seinen Zorn in sich hinein, knurrt beharrlich vor sich hin und holt die Wut erst raus, wenn es wirklich darauf ankommt - dann natürlich im Dienst der Schwachen. Und damit erfüllt er schließlich das Ideal der vor dem Tode Geläuterten.
In Eastwoods Filmen, so hat es einmal eine Kollegin geschrieben, trifft sich Gegenläufiges. In der Komplexität seiner Figuren liegt die Möglichkeit der Veränderung.
Man möchte daran glauben. Man wünschte, man hätte sie noch, die Hoffnungen, die Illusionen aus dem Jahr 2008, und man könnte sich wieder dahinter zurückziehen. Dann würde man sich jetzt, im amerikanischen Präsidentschaftswahljahr, mit Leuten wie Walt und Meistern wie Eastwood auf die Suche nach den Spuren der Veränderung begeben. So hilft nur, "Gran Torino" noch einmal zu schauen. Und abzuwarten. ELENA WITZECK
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
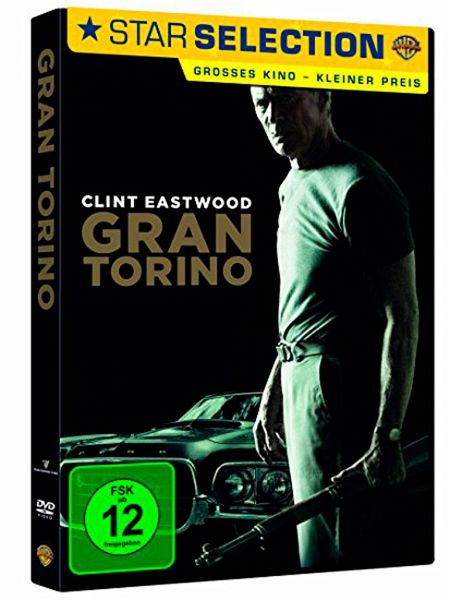





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.01.2024
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.01.2024