zu halten, handelt "The Queen" von Stephen Frears - und zwar in der Person der englischen Königin Elisabeth. Auf den Plakaten am Lido sieht man Helen Mirren überall als Queen herabblicken und fragt sich, was ein Film über sie erzählen könnte. Die Antwort ist überraschend vergnüglich und anrührend und Mirren eine sichere Kandidatin für den Darstellerinnenpreis. Der Film beginnt mit dem Wahlsieg Tony Blairs, erzählt vom Tod Dianas und konzentriert sich auf die Tage danach, als sich die Königsfamilie zum Verdruß der Briten in Balmoral verschanzte und unfähig zu einer angemessenen Reaktion schien. Wenn man nicht wüßte, daß es sich um reale Ereignisse handelt, könnte man das für eine Satire halten. Aber Frears mischt geschickt Fernsehbilder in seine nachgestellten Szenen, so daß man die hysterische Trauer jener Tage fast als Dokufiktion nacherlebt, findet aber doch einen Tonfall, der daraus ein Königsdrama der Mediengesellschaft macht.
Eingestimmt wird man schon durch den Anfang, als Blair seinen Antrittsbesuch im Buckingham Palace machen muß und jeglicher antiroyalistische Impetus durch das strenge Protokoll im Ansatz erstickt wird. Wie ein Pennäler steht der neue Premier vor der Queen, die ihm keinen Schritt entgegenkommt und keine Peinlichkeit erspart. Frears' Kunst liegt darin, sein Publikum von Beginn an auf ihre Seite zu ziehen, um sein Thema um so wirkungsvoller abstecken zu können: die Unvereinbarkeit von Emotion und Etikette. Während das Blumenmeer vor dem Palast wächst und sich die Stimmung langsam gegen die offenbar hartherzige Königin wendet, versucht Blair immer verzweifelter, sie von der Notwendigkeit zu überzeugen, endlich eine Reaktion zu zeigen, die der öffentlichen Erschütterung Rechnung trägt.
Und je mehr sich die Queen versteift, desto erstaunlicher wird Helen Mirrens Kunst, die widersprüchlichen Gefühle ihrer Figur hinter der reglosen Maske sichtbar zu machen. Ein einziges Mal, als ihr Wagen im schottischen Hochland mit einer Panne liegenbleibt und kein Mensch in Sicht ist, erlaubt sie ihren Gefühlen freien Lauf. In diesem Moment taucht wie eine Erscheinung ein Hirsch auf, wie ein Sinnbild für eine Freiheit, die der Queen von Geburt an verwehrt war. "The Queen" ist eine wunderbare Gratwanderung zwischen vergnügtem Spiel und angemessenem Ernst, zwischen historischem Vorbild und künstlerischer Freiheit.
Wo Frears eine Gesellschaft zeigt, die in ihren Ritualen gefangen ist, da erzählt Alfonso Cuarón von einer Welt, die sich ihrer Zukunft beraubt hat. "Children of Men" handelt nach einer Vorlage von P. D. James vom England des Jahres 2027, als der jüngste Mensch der Welt im Alter von achtzehn Jahren stirbt. Die Welt hat aufgehört, Kinder zu kriegen, hat sich offenbar vergiftet und selbst zerfleischt, und nur in England dämmert noch eine überalterte Gesellschaft ihrem Ende entgegen, während sie sich mit brutaler Gewalt gegen Immigranten abschottet. Der Mexikaner Cuarón, Regisseur von "Y tu Mama también" und "Harry Potter und der Gefangene von Askaban", entwirft das beängstigende Bild einer kinderlos-totalitären Welt, die unter verfinstertem Himmel ihrem Ende entgegengeht: eine erschreckend plausible Vision, in der alle Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung als Albtraum wahr werden. Ein Mann (Clive Owen) wird von seiner Exfrau (Julianne Moore) kontaktiert, die im Untergrund kämpft: Er soll einen Passierschein für eine illegale Einwanderin besorgen, die sich als schwanger entpuppt, ein Umstand, der vor allem vor der Staatsmacht geheimgehalten werden muß. Die Erinnerung ans Kinderkriegen ist in diesem Horrorszenario so fern, daß die werdende Mutter ihren Helfer darüber aufklären zu müssen glaubt, daß eine Schwangerschaft neun Monate dauert. So wandelt sich der Zukunftsthriller allmählich zur Erlösungsgeschichte, in der man bis zur letzten Minute den Atem anhält, weil er so hautnah inszeniert ist und vor allem die zeitgemäßen Implikationen dieser Geschichte so unter die Haut gehen.
Im Grunde paßt auch der neue Film von Alain Resnais zu diesem gesellschaftlichen Befund. In "Private Fears in Public Places" inszeniert der Franzose nach einem Theaterstück von Alan Ayckbourne mit seinem Stammpersonal André Dussollier, Sabine Azéma, Pierre Arditi und Lambert Wilson einen tieftraurigen - und völlig kinderlosen - Reigen über die unüberbrückbare Einsamkeit seiner Personen. Eine gewisse Behäbigkeit liegt über der Geschichte, eine allgegenwärtige Erschöpfung, die Resnais nur aufzulösen vermag, indem er in der Studiokünstlichkeit mit stetem Kunstschneetreiben von einer Szene zur nächsten blendet. Am Ende gibt es nur ein Bild, das den Aufwand wirklich lohnt: zwei Menschen, die am Küchentisch ihre Hände nacheinander ausstrecken und plötzlich eingeschneit sind. Draußen auf dem Lido scheint die Sonne, aber im Kino gehen wir Film um Film der nächsten Eiszeit entgegen.
MICHAEL ALTHEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
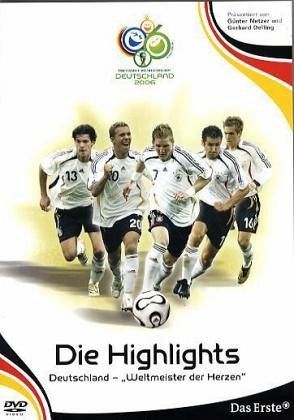





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.09.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.09.2006