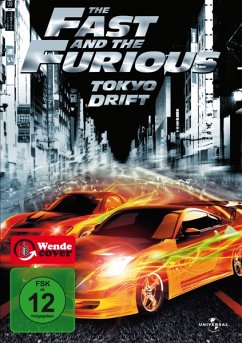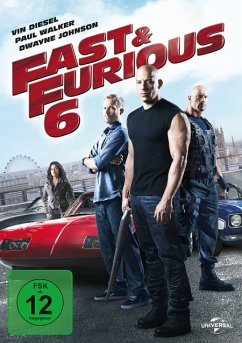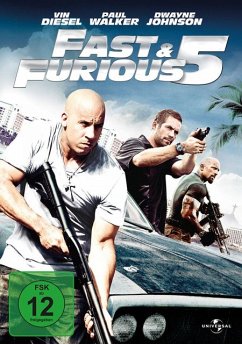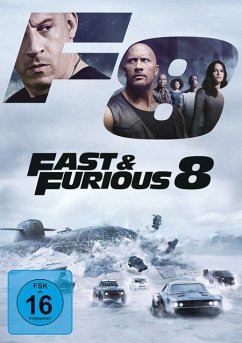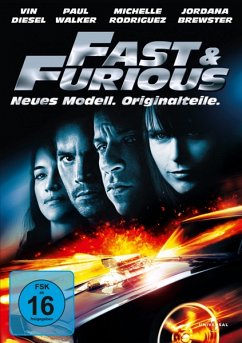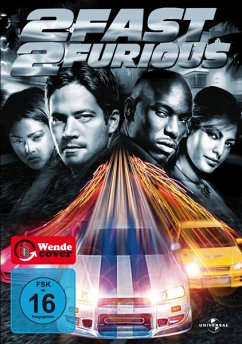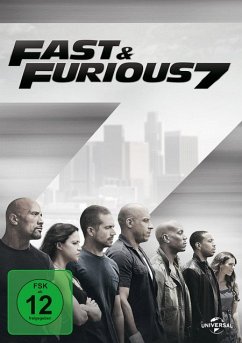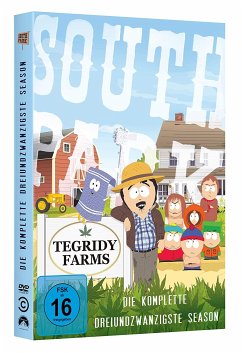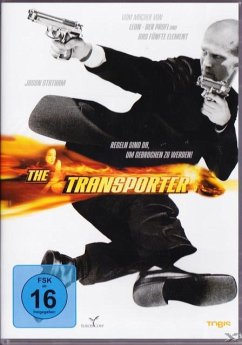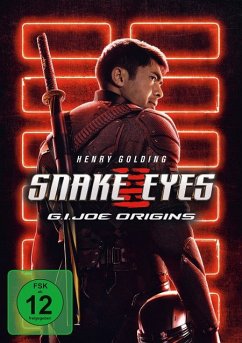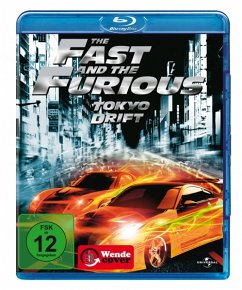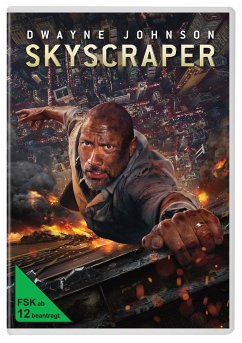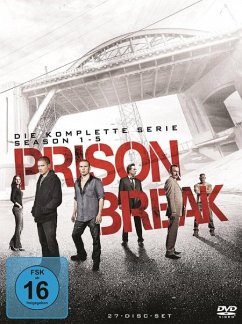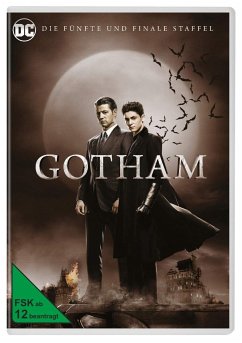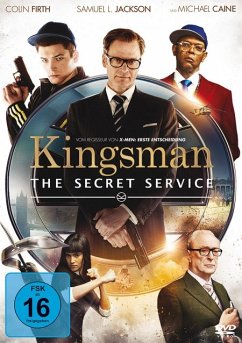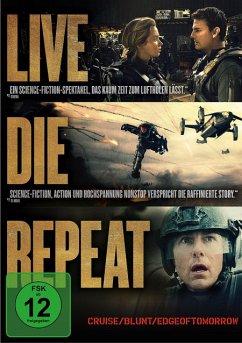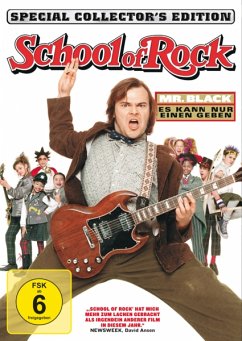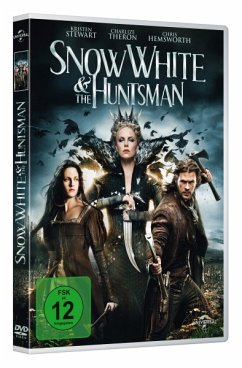DVD
Fast & Furious: Hobbs & Shaw

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!




Dass Feinde zu Freunden oder sogar Familie werden, war von Anfang an eines der wichtigsten Naturgesetze im Fast & Furious-Universum. Hochgetunte Supercars und atemberaubende Action sind immer garantiert - aber das Herz der Blockbuster-Reihe war von Anfang an die besondere Freundschaft der Helden untereinander.
FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW setzt genau hier an. Dwayne Johnson als Secret Service-Agent Luke Hobbs und Jason Statham als geächteter Ex-Elitesoldat Deckard Shaw verpassen seit ihrem ersten Aufeinandertreffen in Fast & Furious 7 keine Gelegenheit, dem anderen das Leben schwer zu machen - und lassen dabei nicht nur Worte, sondern mitunter auch ihre Fäuste sprechen.
Als sie von den bedrohlichen Plänen des internationalen Terroristen Brixton (Idris Elba) erfahren, sehen sie sich gezwungen zusammenzuarbeiten. Durch genetische und kybernetische Weiterentwicklung hat sich Anarchist Brixton zum unschlagbaren Gegner perfektioniert, dem es sogar gelingt, Shaws brillante Schwester (Vanessa Kirby), eine abtrünnige MI6-Agentin, zu überwältigen. Allein haben weder Hobbs noch Shaw eine Chance gegen ihn und so bleibt den beiden Widersachern nichts anderes übrig, als sich gemeinsam in den Kampf zu stürzen.
FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW setzt genau hier an. Dwayne Johnson als Secret Service-Agent Luke Hobbs und Jason Statham als geächteter Ex-Elitesoldat Deckard Shaw verpassen seit ihrem ersten Aufeinandertreffen in Fast & Furious 7 keine Gelegenheit, dem anderen das Leben schwer zu machen - und lassen dabei nicht nur Worte, sondern mitunter auch ihre Fäuste sprechen.
Als sie von den bedrohlichen Plänen des internationalen Terroristen Brixton (Idris Elba) erfahren, sehen sie sich gezwungen zusammenzuarbeiten. Durch genetische und kybernetische Weiterentwicklung hat sich Anarchist Brixton zum unschlagbaren Gegner perfektioniert, dem es sogar gelingt, Shaws brillante Schwester (Vanessa Kirby), eine abtrünnige MI6-Agentin, zu überwältigen. Allein haben weder Hobbs noch Shaw eine Chance gegen ihn und so bleibt den beiden Widersachern nichts anderes übrig, als sich gemeinsam in den Kampf zu stürzen.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Produktdetails
- Anzahl: 1 DVD
- Hersteller: Universal Pictures Video
- Gesamtlaufzeit: 130 Min.
- Erscheinungstermin: 12. Dezember 2019
-
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch
- Untertitel: Deutsch, Türkisch, Griechisch, Englisch
- Regionalcode: 2
- Bildformat: 2.40:1 / SDTV 576i (PAL) / Anamorph
- Tonformat: Deutsch DD 5.1 ...
- EAN: 5053083188290
- Artikelnr.: 57196948
Herstellerkennzeichnung
Universal Pictures Germany GmbH
Christoph-Probst-Weg 26
20251 Hamburg
info@universal-pictures.de
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.08.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.08.2019Der stärkste Muskel des Körpers
Die Actionfilm-Serie "The Fast and Furious" geht mit "Hobbs and Shaw" in die neunte Runde. Fast hätten ein Zitat von Nietzsche und Vanessa Kirby sie gerettet.
An einem dieser bleiernen Sonnentage von Los Angeles betritt ein junger, selbstbewusster Cop mit blonden Locken eine Bar, in der sonst nur Jungs sitzen, die für ein schnelles Auto ihre Seele verkaufen würden. Es ist nicht das erste Mal, er kennt die Gäste, und als er sein Thunfischsandwich bestellt, flirtet er mit der Kellnerin. Wenige Worte genügen, da prügeln sich der Ermittler mit dem Engelshaar und einer der Autotuner schon zwischen grell lackierten Rennfahrzeugen auf der Straße. Wegen der Frau und dem, was die Männergang
Die Actionfilm-Serie "The Fast and Furious" geht mit "Hobbs and Shaw" in die neunte Runde. Fast hätten ein Zitat von Nietzsche und Vanessa Kirby sie gerettet.
An einem dieser bleiernen Sonnentage von Los Angeles betritt ein junger, selbstbewusster Cop mit blonden Locken eine Bar, in der sonst nur Jungs sitzen, die für ein schnelles Auto ihre Seele verkaufen würden. Es ist nicht das erste Mal, er kennt die Gäste, und als er sein Thunfischsandwich bestellt, flirtet er mit der Kellnerin. Wenige Worte genügen, da prügeln sich der Ermittler mit dem Engelshaar und einer der Autotuner schon zwischen grell lackierten Rennfahrzeugen auf der Straße. Wegen der Frau und dem, was die Männergang
Mehr anzeigen
ihre Ehre nennt. Das war das Setting von "The Fast and Furious".
Es folgten sieben Filme, in der sich wechselnde Besetzungen Verfolgungsjagden mit der Polizei lieferten, in Autokolonnen durch Palmenalleen schlängelten und in endlosen Variationen aufs Gaspedal traten. Zu den Regeln des Spiels gehörte, dass die Männer fuhren, während die Frauen in Glitzerbikinis warteten und ihre Körper dem prognostizierten Gewinner versprachen. Die einen, vor allem Tuningfans, liebten die rauchenden Motorhauben. Die anderen konnten das Gewese nicht verstehen. Das war kein großes Kino, das war dumpf. Dann starb Paul Walker, der Cop mit den Engelslocken. Er raste mit einem Porsche gegen einen Baum. Das ist der Horizont, über dem sich das "Fast and Furious"-Imperium spannt.
Achtzehn Jahre sind seit dem ersten Film vergangen. In der neuen Folge nun schließen sich zwei der Charaktere aus den späteren Filmen, der ehemalige Militärsoldat Deckard Shaw (Jason Statham) und der Agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson) mit Shaws im Nahkampf ausgebildeter Schwester Hattie (Vanessa Kirby) zusammen, um einen größenwahnsinnigen, zur Killermaschine aufgerüsteten Terroristen zu stoppen. Dass nicht alle direkt und indirekt am Imperium Beteiligten mit dem Spin-off einverstanden waren, hatte mit dem hymnischen Gedenken an Walker, der Anzahl der an der Produktion beteiligten Egos und der Ankündigung zu tun, "Hobbs & Shaw" solle anders werden als die bisherigen Folgen, weniger albern, weniger Autos. Und weil David Leitch als Regisseur verpflichtet wurde: mehr Fausthiebe von Frauen.
Die Agentin Hattie ist das Ass, das Leitch aus seiner konventionellen Actiongeschichte zaubert: Mit einem Virus droht die mächtige Firma Etion, die auch die britischen Medien kontrolliert, die Menschheit zu vernichten, alle "Schwachen" zu eliminieren und einen "perfekten Staat" zu errichten. Die Killermaschine Brixton, die eigentlich nur als Handlanger dient, nennt es einen "notwendigen Schock" für ein pervertiertes System, in dem sich die Menschen ohnehin zugrunde richten. Hattie hat sich das Virus injiziert, warum, spielt jetzt keine Rolle mehr, denn es bleiben nur ein paar Stunden, um sie und die Welt zu retten. Ihr - und den haarlosen Männern.
Das Kalkül, mit Actionfilmen über kompromisslose Frauen Geld zu verdienen, hat David Leitch zuletzt als Regisseur von "Atomic Blonde" angewandt. Charlize Theron schritt da als Killerin Lorraine im weißen Lackmantel durch Berlin, badete in Eiswürfeln, um ihren geschundenen Körper zu kühlen, schlief mit Frauen und fuhr mit vor Furcht zitternden Männern auf dem Beifahrersitz durch Ost-Berlin. Man sah in ihr etwas, das neugierig machte - eine zur Kämpferin trainierte Frau, die ohne das übliche Geschrei über Grazie und die Taktik im Angriff verfügte, die ein leichter Körper beim Zusammenstoß mit mehreren schweren braucht. Vanessa Kirby, die Agentin mit den Katzenaugen, die in "The Crown" mitspielte, der Netflixserie über Königin Elisabeth II., ist als Hattie zugänglicher als Charlize Theron als Lorraine, impulsiver, aber genauso eigenwillig. Und während Lorraine noch mit Küchengeräten warf, übernimmt das in "Fast and Furious" Jason Statham, der so messianisch auftritt, wie man es von ihm gewohnt ist, nur jetzt im Schatten seiner Schwester.
Chris Morgan, der seit "Tokyo Drift" die Mehrzahl der Drehbücher schrieb, passte sich den neuen Begebenheiten an. "Der Geist ist der stärkste Muskel des Körpers", lässt er Hattie deklarieren. Vielleicht sollte Hobbs, mit dem sie längst flirtet, den mal trainieren. Aber der? Antwortet mit einem Zitat von Nietzsche.
Um die Menschheit zu retten, bedarf es heute keiner Sportwagen mehr. Sie stehen im Keller, wenn sie nicht gerade für einen kurzen Ausflug durch London gebraucht werden, bei dem der Motorradfahrer auf Verfolgungskurs durch den Doppeldeckerbus, Wahrzeichen britischer Größe, fliegt und ein klaffendes Loch hinterlässt. Hörte man nicht so regelmäßig Sätze wie "Zeit, mal die Muskeln spielen zu lassen" und "Beeilung, der Zug verlässt den Bahnhof", man würde nicht müde, nach Metaphern für eine sich wandelnde Gegenwart zu suchen.
Von den Klischees von 2001 ist wenig übrig, aber die Welt der Schnellen und Wilden, in der ein Bruder seine Schwester noch "die Kleine" nennen darf, hat neue dazugewonnen. Waffendepots gibt es bei russischen Mafiabräuten in Moskau. Mit Badelatschen werfende, runde Mütter in Samoa, Hobbs' Heimat. Spät, aber tröstlich erfolgt die Erkenntnis, dass ein mächtiger Gegenspieler nur mit einer gemeinsamen Taktik besiegt werden kann. "Du glaubst vielleicht an Maschinen - wir glauben an Menschen", geben die Verbrüderten dem Besiegten schließlich mit: Du hast womöglich jede Technik dieser Welt, aber wir haben Herzen. Für die Technik, die sie früher beschworen, haben die Helden nichts mehr übrig.
Ein Abend vor dem Showdown. Zwei Männer sitzen im Flugzeug, neben ihnen schläft eine Frau, die aus schwer ersichtlichen Gründen Hattie heißt. Der eine, ihr Bruder, wirft dem anderen vor, Hattie abschleppen zu wollen. "Wir sind nicht mehr im Jahr 1955", erwidert der andere, entrüstet. Die Frau entscheide schließlich selbst, wer für sie in Frage komme. Die Männer beschimpfen sich noch eine Weile, dann lassen sie voneinander ab.
Das ist "The Fast and Furious" im Jahr 2019. Die Zeit der Machos am Gaspedal ist vorbei. Was früher die Community der Autotuner elektrisierte, soll jetzt für alle funktionieren. Ein schlechter Film wird nicht dadurch besser, dass er von einer spannenden Frau handelt. Aber er verrät viel über seine Zeit.
ELENA WITZECK
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Es folgten sieben Filme, in der sich wechselnde Besetzungen Verfolgungsjagden mit der Polizei lieferten, in Autokolonnen durch Palmenalleen schlängelten und in endlosen Variationen aufs Gaspedal traten. Zu den Regeln des Spiels gehörte, dass die Männer fuhren, während die Frauen in Glitzerbikinis warteten und ihre Körper dem prognostizierten Gewinner versprachen. Die einen, vor allem Tuningfans, liebten die rauchenden Motorhauben. Die anderen konnten das Gewese nicht verstehen. Das war kein großes Kino, das war dumpf. Dann starb Paul Walker, der Cop mit den Engelslocken. Er raste mit einem Porsche gegen einen Baum. Das ist der Horizont, über dem sich das "Fast and Furious"-Imperium spannt.
Achtzehn Jahre sind seit dem ersten Film vergangen. In der neuen Folge nun schließen sich zwei der Charaktere aus den späteren Filmen, der ehemalige Militärsoldat Deckard Shaw (Jason Statham) und der Agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson) mit Shaws im Nahkampf ausgebildeter Schwester Hattie (Vanessa Kirby) zusammen, um einen größenwahnsinnigen, zur Killermaschine aufgerüsteten Terroristen zu stoppen. Dass nicht alle direkt und indirekt am Imperium Beteiligten mit dem Spin-off einverstanden waren, hatte mit dem hymnischen Gedenken an Walker, der Anzahl der an der Produktion beteiligten Egos und der Ankündigung zu tun, "Hobbs & Shaw" solle anders werden als die bisherigen Folgen, weniger albern, weniger Autos. Und weil David Leitch als Regisseur verpflichtet wurde: mehr Fausthiebe von Frauen.
Die Agentin Hattie ist das Ass, das Leitch aus seiner konventionellen Actiongeschichte zaubert: Mit einem Virus droht die mächtige Firma Etion, die auch die britischen Medien kontrolliert, die Menschheit zu vernichten, alle "Schwachen" zu eliminieren und einen "perfekten Staat" zu errichten. Die Killermaschine Brixton, die eigentlich nur als Handlanger dient, nennt es einen "notwendigen Schock" für ein pervertiertes System, in dem sich die Menschen ohnehin zugrunde richten. Hattie hat sich das Virus injiziert, warum, spielt jetzt keine Rolle mehr, denn es bleiben nur ein paar Stunden, um sie und die Welt zu retten. Ihr - und den haarlosen Männern.
Das Kalkül, mit Actionfilmen über kompromisslose Frauen Geld zu verdienen, hat David Leitch zuletzt als Regisseur von "Atomic Blonde" angewandt. Charlize Theron schritt da als Killerin Lorraine im weißen Lackmantel durch Berlin, badete in Eiswürfeln, um ihren geschundenen Körper zu kühlen, schlief mit Frauen und fuhr mit vor Furcht zitternden Männern auf dem Beifahrersitz durch Ost-Berlin. Man sah in ihr etwas, das neugierig machte - eine zur Kämpferin trainierte Frau, die ohne das übliche Geschrei über Grazie und die Taktik im Angriff verfügte, die ein leichter Körper beim Zusammenstoß mit mehreren schweren braucht. Vanessa Kirby, die Agentin mit den Katzenaugen, die in "The Crown" mitspielte, der Netflixserie über Königin Elisabeth II., ist als Hattie zugänglicher als Charlize Theron als Lorraine, impulsiver, aber genauso eigenwillig. Und während Lorraine noch mit Küchengeräten warf, übernimmt das in "Fast and Furious" Jason Statham, der so messianisch auftritt, wie man es von ihm gewohnt ist, nur jetzt im Schatten seiner Schwester.
Chris Morgan, der seit "Tokyo Drift" die Mehrzahl der Drehbücher schrieb, passte sich den neuen Begebenheiten an. "Der Geist ist der stärkste Muskel des Körpers", lässt er Hattie deklarieren. Vielleicht sollte Hobbs, mit dem sie längst flirtet, den mal trainieren. Aber der? Antwortet mit einem Zitat von Nietzsche.
Um die Menschheit zu retten, bedarf es heute keiner Sportwagen mehr. Sie stehen im Keller, wenn sie nicht gerade für einen kurzen Ausflug durch London gebraucht werden, bei dem der Motorradfahrer auf Verfolgungskurs durch den Doppeldeckerbus, Wahrzeichen britischer Größe, fliegt und ein klaffendes Loch hinterlässt. Hörte man nicht so regelmäßig Sätze wie "Zeit, mal die Muskeln spielen zu lassen" und "Beeilung, der Zug verlässt den Bahnhof", man würde nicht müde, nach Metaphern für eine sich wandelnde Gegenwart zu suchen.
Von den Klischees von 2001 ist wenig übrig, aber die Welt der Schnellen und Wilden, in der ein Bruder seine Schwester noch "die Kleine" nennen darf, hat neue dazugewonnen. Waffendepots gibt es bei russischen Mafiabräuten in Moskau. Mit Badelatschen werfende, runde Mütter in Samoa, Hobbs' Heimat. Spät, aber tröstlich erfolgt die Erkenntnis, dass ein mächtiger Gegenspieler nur mit einer gemeinsamen Taktik besiegt werden kann. "Du glaubst vielleicht an Maschinen - wir glauben an Menschen", geben die Verbrüderten dem Besiegten schließlich mit: Du hast womöglich jede Technik dieser Welt, aber wir haben Herzen. Für die Technik, die sie früher beschworen, haben die Helden nichts mehr übrig.
Ein Abend vor dem Showdown. Zwei Männer sitzen im Flugzeug, neben ihnen schläft eine Frau, die aus schwer ersichtlichen Gründen Hattie heißt. Der eine, ihr Bruder, wirft dem anderen vor, Hattie abschleppen zu wollen. "Wir sind nicht mehr im Jahr 1955", erwidert der andere, entrüstet. Die Frau entscheide schließlich selbst, wer für sie in Frage komme. Die Männer beschimpfen sich noch eine Weile, dann lassen sie voneinander ab.
Das ist "The Fast and Furious" im Jahr 2019. Die Zeit der Machos am Gaspedal ist vorbei. Was früher die Community der Autotuner elektrisierte, soll jetzt für alle funktionieren. Ein schlechter Film wird nicht dadurch besser, dass er von einer spannenden Frau handelt. Aber er verrät viel über seine Zeit.
ELENA WITZECK
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für