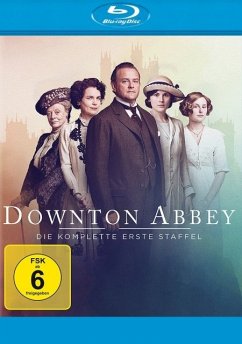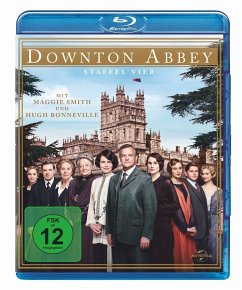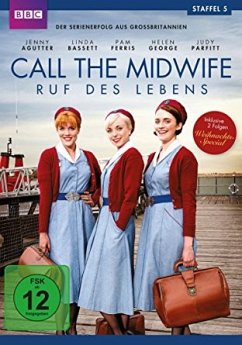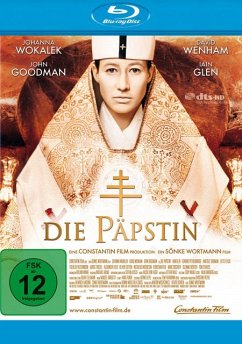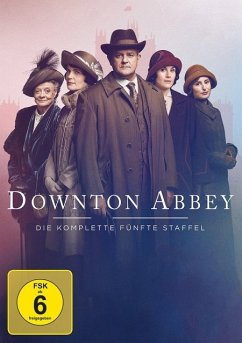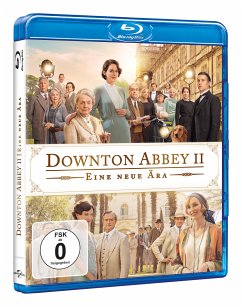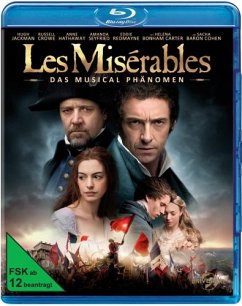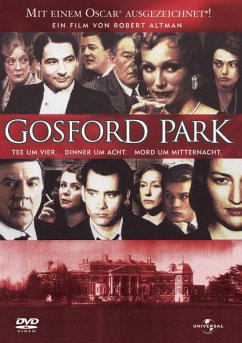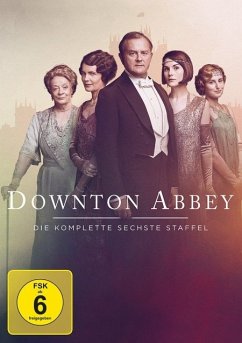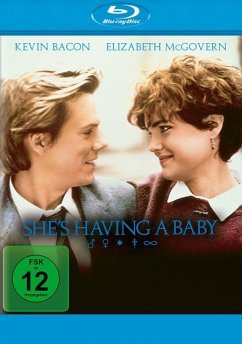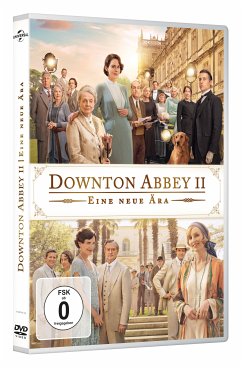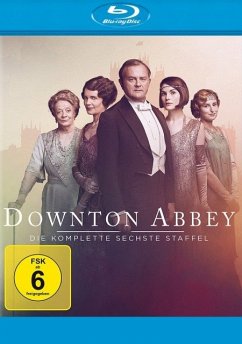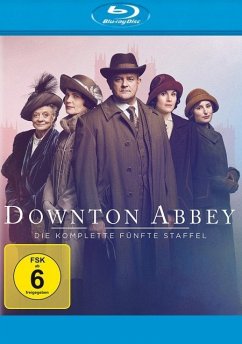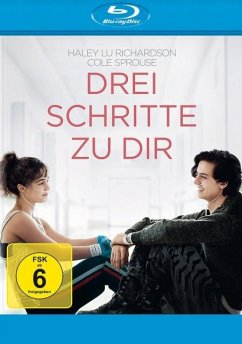Fellowes mitproduzierten Kinofortsetzung will man das einfach nicht mehr glauben: Downton atmet und strahlt. Downton ist riesig, grün und üppig, weil diesmal das Geld dafür da war. Doch wenn die Blicke lange genug über kostbar schimmerndes Holz und blitzendes Teegeschirr geglitten sind, will man als Zuschauer vielleicht doch eine etwas tiefere, sagen wir: transzendentere Frage beantwortet bekommen als jene, die aus der 2015 verabschiedeten Serie in den Film hinüberschwappt: "Was machen wir mit Downton?"
Ja, was sollen sie, die verarmten Crawleys, mit Downton machen? Das, was sie immer mit Downton gemacht haben, Dummchen! Sich daran klammern. Die Bräuche der englischen Aristokratie bewahren, als gäbe es keine Zeit, keine Geschichte, keine Veränderung. Und die harte Wirklichkeit von Downton fernhalten, so gut und lange es eben geht. Insofern benutzt der Film durchaus dieselben Motive wie die Fernsehserie: Abermals liefern sich die Lady Dowager Violet Crawley (die formidable, inzwischen 84 Jahre alte Maggie Smith) und ihre bürgerliche Verwandte Isobel Grey (Penelope Wilton) scharfzüngige Wortgefechte, mit weitem Abstand das Aufregendste, was in den sonst tantenhaften Dialogen zu hören ist. Abermals blickt der ältliche Hausherr Robert Crawley (Hugh Bonneville) mit routinierter Besorgtheit über die Szenerie, als wäre von ihm irgendetwas anderes gefordert, als routiniert besorgt zu blicken. Und auch diesmal gibt es hübsche Reibungen, aber auch subtile Echos zwischen der oben residierenden aristokratischen Familie und dem unten herumwuselnden Gesinde in Küche und Keller.
Nur dass dem schlichten Plot - wir befinden uns im Jahr 1927, das Königspaar hat seinen Besuch angekündigt, und Downton "wants to look its best" - jegliche epische Weite fehlt. Und damit gehen auch die dramatischen Verknüpfungen zwischen den geduldig über sechs Staffeln hinweg geflochtenen Figurenbeziehungen verloren. Diesmal dreht es sich wirklich nur darum, ohne Blamage den Tag und die Nacht zu überstehen, und man verrät nicht zu viel, wenn man andeutet, dass die Downton-Dienerschaft um den aus dem Ruhestand zurückgeholten Chefbutler Carson (Jim Carter) sich mit List und Pfadfinderenthusiasmus gegen die Entourage des Königshauses durchsetzt: country beats city. Das lachhafte Attentat auf König George V. dagegen, das der vormalige irische Revoluzzer und jetzt zur englischen Oberklasse bekehrte Tom Branson (Allen Leech) verhindert - es bekommt im Film weniger screen time als die Patzer eines nervösen Dieners beim Servieren.
Was unterscheidet die Fernsehserie sonst noch von der Fortsetzung fürs Kino? Die erste ist vor dem Brexit-Referendum gedreht worden, die zweite danach. Und damit darf man fragen, ob uns diese schwelgerische Produktion eine Botschaft für die politische Gegenwart und das Vereinigte Königreich unter Premier Boris Johnson mitgeben will. Vielleicht sollte man die durchweg hinreißenden Darstellerinnen einmal dafür loben, dass sie auch als Privatpersonen meistens die Wahrheit gesagt haben - vor dem Dreh, während des Drehs und nach dem Dreh. Maggie Smith, die große Dame, die auf keinen Fall nur mit "Downton Abbey" identifiziert werden mag, vermutlich, weil sie dereinst als echte Schauspielerin vor den Herrgott treten will, hatte vor Jahren eine Fortsetzung kategorisch ausgeschlossen, und sie dürfte geahnt haben, warum. Erst als alle anderen ihre Engagementverträge unterschrieben hatten, so heißt es, kam auch sie an Bord. Michelle Dockerey, als Lady Mary eine der tragenden Figuren, verriet der Zeitung "The Independent", dass sie und andere Kolleginnen die wenig subtile Lehre aus dem Kostümdrama sehr wohl verstanden hätten: Eskapismus. Der Interviewer hatte "Ablenkung" vorgeschlagen.
In einer der intensiveren Szenen prophezeit die alte Violet Crawley ihrer Enkelin Mary, auch sie werde einst eine "furchterregende alte Lady" werden wie sie selbst. "Ich lebe in dir weiter", fügt sie hinzu. Es ist ein emotionaler Augenblick. Nicht nur zwei starke Schauspielerinnen, zwei Generationen blicken sich hier über eine Kluft von fünfzig Jahren hinweg an. Und das schöne Pathos legt nahe: Du wirst weitermachen, wo ich aufhöre, und mithelfen, unsere Welt - die beste aller denkbaren Welten - zu bewahren. Es ist eine Hoffnung, aber auch ein Auftrag. Immer wieder schaut "Downton Abbey" so in die Zukunft. Selbst der schwule Thomas Barrow, vom bösen Kammerdiener zum akzeptierten Mitläufer mutiert, darf 1927 auf dem platten Land sinnieren: "Wird man uns jemals für gleichberechtigt halten?"
Nein, gegen gesellschaftliche Modernisierung, wo sie die Rechte sexueller Minderheiten betrifft, will "Downton Abbey" nichts haben, man geht doch mit der Zeit. Aber Lady Edith wird unverhohlen empfohlen, an einer seelenlosen Ehe festzuhalten, um das morsche Gebälk der Oberklasse zu stützen. Dieser Film ist ein fein poliertes Produkt, das die Flucht aus der Wirklichkeit zur Lebensmaxime erhebt und dies auch dem Publikum aller Schichten und Altersstufen anempfiehlt. Menschliches Drama und reale Konflikte werden dabei nur aktiviert, um sie in den Dienst willfährigen Maulhaltens zu stellen. Denn die englische Aristokratie und ihre Werte - Geld, privilegierte Bildung, tapfer verteidigte Herrenhäuser und wangenrötende Landluft - erhalten durch "Downton Abbey" das Siegel des Echten, Bewahrenswerten, forever and ever. Und damit auch die Brexit-Meistererzählung vom "Eigenen", das durch die Berührung mit "Europa" besudelt zu werden drohe. Die Londoner Presse spekuliert schon darüber, wann "Downton"-Erfinder Julian Fellowes, ein Peer im britischen Oberhaus und überzeugter Brexiteer, mit der Beförderung in den Ritterstand rechnen darf.
PAUL INGENDAAY
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
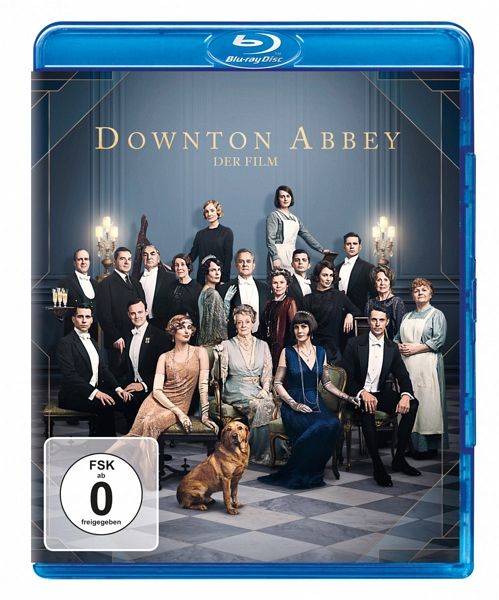







 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.09.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.09.2019