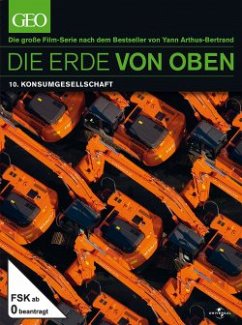Kommilitonen Luigi Farlorni gedreht hat und der nun in der Kategorie Bester Dokumentarfilm für den Oscar nominiert ist.
Die Geschichte spielt in der Mongolei, im südlichen Teil der Wüste Gobi, dort, wo Begriffe wie Zeit und Entfernung vor der Weite des Landes kapitulieren. Ein Kamel wird geboren. Seit Stunden schon wälzt sich die Stute im Wüstensand, steht auf, taumelt, zuckt und sinkt unter einem milchig-blauen Himmel wieder in die Knie. Der Kopf des Jungtieres erscheint; sehr vorsichtig ziehen zwei Nomaden an den Gliedmaßen, befreien Mutter und Kind von ihren Qualen. Das Kamel, das sich den Weg in die Welt so hart erkämpfen muß, ist ein besonders hübsches - und es ist weiß. Rasch stellt es sich auf seine dünnen Beine und pirscht sich wackelnd an die Mutter heran, als wäre es betrunken. Die Mutter aber trabt davon.
Dieser Film erzählt vom Verlust und Wiedergewinn der Liebe, von Sehnsucht und Geborgenheit, von der Weite des Landes und von dessen Menschen. Und dabei gelingt das schier Unmögliche: Es gibt nicht einen Augenblick, in dem die Geschichte das Spiel mit den Emotionen zu verlieren droht oder in seichtes Gewässer abgleitet. Alles, so scheint es, geht seinen natürlichen Gang, und wie zufällig steht immer eine Kamera in der Nähe, die alles festhält: Man sieht, wie zwei Nomadenkinder den Weg in die nächstgelegene Stadt antreten, wie sie zuversichtlich ihre Kamele satteln und in der Hoffnung losreiten, dort den Geiger zu finden, der durch sein Spiel das Herz der Kamelmutter erweichen kann - so will es ein altes Ritual. Und so geschieht es auch, ganz leise, in der Einsamkeit der Wüste Gobi. Es ist der schönste Moment einer sehr schönen Geschichte. Auch für das Filmteam, für Byambasuren Davaa, die hoffte, bangte, weinte und schließlich, als alles wunderbar geklappt hatte, es kaum fassen konnte. "Wir hatten kein Drehbuch", sagt sie etwas verlegen. Ihre Worte klingen, als müsse sie sich dafür entschuldigen. "Wir hatten eine Idee, ein Skript und unsere Hoffnung."
Byambasuren Davaa ist Mongolin und wurde 1971 in der Hauptstadt Ulan Bator geboren. "Wir, meine sechs Geschwister und ich, sind die erste Stadtgeneration", sagt sie. Dennoch sei ihr das Nomadendasein vertraut; schließlich zogen die Eltern und Großeltern viele Jahre mit ihren Tieren durch die Wüste, bevor sie in die Stadt kamen. Von dieser Zeit erzählte ihr die Großmutter oft wunderbare Geschichten, die stets einen märchen- und fabelhaften Charakter besaßen und von denen sie bis heute kaum eine vergessen hat. Wie ihr auch jenes Versöhnungsritual keine Ruhe mehr ließ, seit sie in einer Dokumentation des mongolischen Fernsehens davon hörte. Nun hat sie ihren eigenen Film darüber gedreht und sich damit gleichsam einen Kindheitstraum erfüllt.
Ihre Liebe zu bewegten Bildern ließ sie an der Hochschule Ulan Bators acht Semester Filmgeschichte studieren, unter Bedingungen, die sie heute als miserabel bezeichnet. Dem Institut fehlte das Geld. Einen exotischen Studiengang wie den ihren wollte und konnte niemand unterstützen. Daß ihr der Abschluß keine Perspektiven bot, paßte nur ins Bild; auf eine Filmemacherin hatte die Mongolei nicht eben gewartet. Ihren Weg verfolgte sie dennoch hartnäckig und bewarb sich an der Hochschule für Fernsehen und Film in München, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Der erste Versuch scheiterte, weil sie ihr Visum nicht rechtzeitig erhielt; beim zweiten hatte sie Glück.
1999 verließ sie Ulan Bator Richtung Deutschland, weil sie hier keine Studiengebühren zahlen mußte, denn die hätte sie sich nicht leisten können. Der Abschied sei tränenreich gewesen, sagt sie, weil ihr die Geborgenheit innerhalb der Großfamilie sehr viel bedeute. "Man lernt, den anderen zu akzeptieren und ihn so zu nehmen, wie er ist, mit all seinen Stärken und Schwächen." Trotzdem sei sie durch eine harte Schule gegangen, immerhin habe sie fünf Brüder.
In Deutschland angekommen, dauerte es eine Weile, bis sich Byambasuren Davaa einlebte, die Sprache lernte, die sie heute perfekt spricht, mit einem hübschen bayerischen Akzent. An ihren Traum, irgendwann einen Film in der mongolischen Wüste zu drehen, dachte sie zunächst fast gar nicht - bis sie eines Tages von einer Dozentin angesprochen wurde, die ihr versprach, sie dabei zu unterstützen.
Im Januar 2002 reisten Byambasuren Davaa und Luigi Falorni zum ersten Mal gemeinsam in die Mongolei. "Wir wußten genau, wonach wir suchten", sagt sie. Eine große Nomadenfamilie mit Kindern wollten sie finden, eine, die schon seit Generationen durch die Wüste zieht. "Und natürlich mußte unsere Filmfamilie eine große Kamelherde mit einigen trächtigen Stuten besitzen." Alles weitere überließen sie dem Zufall. Innerhalb von zwei Wochen legten die Filmemacher in ihrem Geländewagen rund 4000 Kilometer zurück und trotzten jedem Sandsturm, fuhren die Dünen hinauf und wieder hinunter, bis sie den Süden, den landschaftlich schönsten Teil der Wüste, erreichten. Und dort fanden sie, nachdem sie einige Nomaden gecastet hatten, endlich die für den Film perfekte Familie: Vier Generationen lebten dort mit einer stattlichen Kamelherde, die den Fremden mit freundlicher Neugierde begegneten. Auf das Abenteuer Film schienen sie sich zu freuen. "Wir hatten großes Glück, diesen Menschen zu begegnen", sagt Byambasuren Davaa heute, "denn die klimatisch extremen Bedingungen der vergangenen drei Jahre, die sehr kalten Winter und trockenen, regenarmen Sommer trieben viele Nomaden in die Städte."
Drei Monate später, im April, reisten Byambasuren Davaa und Luigi Falorni abermals in die Mongolei, begleitet von einem Filmteam. Diesmal sollten sie acht Wochen bleiben. Die Anspannung sei enorm gewesen, sagt sie. "Es ging um alles, wir wollten das Vertrauen jener Menschen nicht enttäuschen, die an uns und dieses Projekt glaubten." Als sie bei der Familie eintrafen, lagen im Wüstensand schon die ersten Neugeborenen und versuchten ihre schwachen Beine zu kontrollieren. Sie bauten ein Zelt auf, ihre Kameras und warteten zehn Tage. Nur zehn Tage, bis geschah, worauf das Team so sehr gehofft hatte: Eine Kamelmutter verstieß ihr Junges. "In diesem Augenblick waren wir alle erleichtert, obwohl uns das niedliche Kleine natürlich leid tat, denn ohne die Milch der Mutter hatte es keinerlei Überlebenschance."
An die Macht des Rituals glaubte sie stets, denn nie hatte sie gehört, daß es einmal nicht funktionierte. Es sollte einen halben Tag dauern, bis das Geigenspiel und der traurige Gesang der Großmutter das Kamel zu Tränen rührten. Diesen eindringlichen Moment fängt die Kamera mit großem Geschick und ohne Voyeurismus ein, sie verleiht den Bildern auf diese Weise etwas Zufälliges und angenehm Unangestrengtes. So leicht, wie die Bilder am Ende wirken, ließen sie sich hingegen nicht filmen. Oft reagierten die Kamele irritiert. Näherte sich ihnen eine Kamera, spuckten einige den übelriechenden Inhalt ihres Mauls in Richtung Filmteam.
Als Byambasuren Davaa knapp drei Jahre nach den Dreharbeiten von der Oscar-Nominierung erfuhr - den Bayerischen Filmpreis erhielt sie bereits und überdies den Dokumentarfilmpreis der "Directors Guild of America (DGA)" -, eilte sie gerade die Gänge der Hochschule entlang. "Ich mußte sofort meinen Zahnarzt anrufen", sagt sie "denn seit Monaten schon wollte ich einen Termin vereinbaren." Das ist ihre Art, in jenem Augenblick der inneren Unruhe einen klaren Gedanken zu fassen. Aber natürlich sei es ein seltsames Gefühl, nach Amerika zu fliegen und über den roten Teppich schreiten zu dürfen, neben all den Leinwandstars und Superregisseuren, als Teil eines größeren Ganzen. "Geschichten in Bilder zu verpacken", sagt sie "ist einfach mein Leben." Und weil das so ist, bastelt sie schon an einem neuen Projekt. "Die Höhle des gelben Hundes" soll der Film heißen und wieder spielt er in der Mongolei.
MELANIE MÜHL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
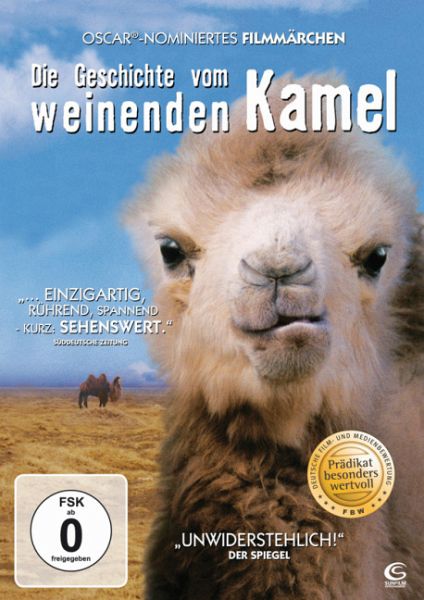





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.02.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.02.2005