gleiche Mann sind. Den einen wie den anderen spielt der spanische Schauspieler Javier Bardem. Und das - wenn schon sonst nichts aus dem aktuellen Katalog der Kinofabeltiere zwischen Gollum und Julia Roberts - muß man gesehen haben.
Pedro Almodóvar und Bigas Luna haben Bardem fast gleichzeitig entdeckt, Anfang der neunziger Jahre. Bei Almodóvar, in "High Heels", war er ein Fernsehmann, eine Randfigur neben Victoria Abril und Marisa Paredes. Für Bigas Luna spielte er dann in "Jamón, jamón" den Macho, der mit der Schinkenkeule um seine Braut kämpft, und diese Rolle blieb an ihm haften. Seine nächsten Filme hießen "Mund zu Mund", "Liebe schadet der Gesundheit" und "Zwischen deinen Beinen". Als Gegengift ließ ihn Almodóvar 1997 in "Live Flesh" den querschnittsgelähmten David spielen, einen Mann, der die körperliche Liebe nur noch in der Erinnerung erlebt. Aber erst mit Julian Schnabels "Before Night Falls" hat sich Bardem endgültig aus den Ketten seiner Anfänge befreit.
"Before Night Falls", der vor vier Jahren in Venedig den Spezialpreis der Jury gewann und nächste Woche bei uns ins Kino kommt, erzählt die Lebensgeschichte des kubanischen Schriftstellers Reinaldo Arenas, von seiner Kindheit als Sohn armer Landarbeiter bis zu seinem Tod 1990 in New York. Zehn Jahre vorher, nach Folter, Zuchthaus und Schreibverbot, war Arenas zusammen mit anderen "Unerwünschten" aus Castros Kuba abgeschoben worden. Aidskrank, allein und verarmt, nahm er Tabletten und zog sich eine Plastiktüte über den Kopf, um sein Leben zu beenden.
Das gäbe genügend Stoff für ein pompöses Künstlermartyrium, aber Schnabel hat ein dunkles Märchen daraus gemacht, eine Tragödie mit farcehaften Zügen. Arenas-Bardem, ein karibischer Caliban mit flackerndem Blick und flattrigen Fingern, durchlebt alle Qualen eines politisch und sexuell Verfolgten, aber er spielt auch mit seinem Leiden, verlacht es, macht es zu Kunst. Daß Julian Schnabel, der Regisseur, Maler ist, sieht man weniger an einzelnen Einstellungen als an ihrer Montage, die dem Auftragen von Farben auf eine Leinwand gleicht, ein wildes Gemisch aus Straßen- und Traumrealität, wie man es im Kino selten sieht. Wenn Arenas am Ende Selbstmord begeht, weiß man nicht, ob man lächeln oder weinen soll, so sehr ist noch sein Tod ein Akt des Widerstands, eine Unabhängigkeitserklärung der Poesie.
Der arbeitslose Santa in Fernando León de Aranoas "Montags in der Sonne" ist eher ein ferner Verwandter als ein Gegenbild des kubanischen Dichters, ein Nonkonformist aus Not, nicht aus Passion. Sein Konto ist leer, sein Kampfesmut ungebrochen: Für die bei der Werftbesetzung zerstörte Straßenlaterne, die er ersetzen muß, zertrümmert er eine neue. Das einzige, was man Aranoas in Spanien preisgekröntem Film vorwerfen kann, ist, daß er es versäumt, seiner Hauptfigur eine Geschichte zu geben. Denn über Santas Leben erfahren wir so gut wie nichts, dafür um so mehr über die Schicksale seiner Freunde: Einer bewirbt sich auf jede offene Stelle, ein anderer läßt sich von seiner Ehefrau aushalten, ein dritter, dem die Frau weggelaufen ist, flüchtet aus seinem Elend in den Tod.
"Montags in der Sonne" ist, obwohl die Handlung zum größten Teil aus Männergesprächen besteht, ein Film, der vom Ungesagten lebt, von dem, was die markigen Sprüche, die gleichgültigen Mienen verschweigen. Mehr als um alles andere geht es um Stolz in dieser Geschichte, um das Gefühl, etwas wert zu sein, trotz der Entwertung durch den Arbeitsmarkt. Es ist vor allem Bardems massiver Leib, der diesem Stolz eine Form gibt, so wie er, verwandelt, das Begehren des Dichters ausgedrückt hat. Man erkennt ihn nicht wieder, und doch würde man ihn unter Tausenden erkennen. Mehr kann man von einem Filmschauspieler nicht verlangen.
ANDREAS KILB
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
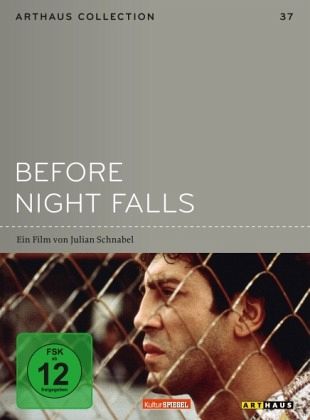





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.01.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.01.2004