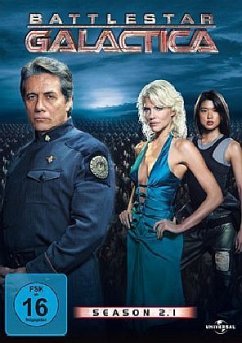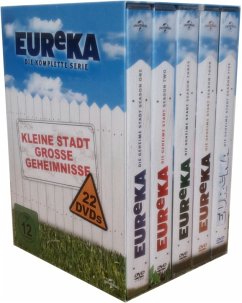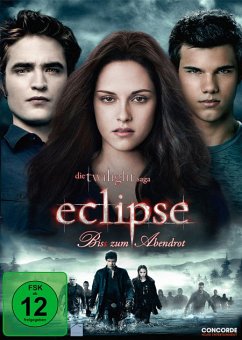emphatischen Sinn) fungieren als Mikroskop. Sie machen sichtbar, was sich sonst dem Blick entzieht. Staub wird erst wahrgenommen, wenn sich die Teilchen zu einer Schicht geformt haben, wenn diese Schicht sich auf einem lange ungelesenen Buch ablagert, wenn die winzigen Milben, die im Staub leben, zu einer Allergie führen oder aber wenn das Sonnenlicht in einen Raum fällt und die Partikel in der Luft es reflektieren. Staub ist überall, aber reicht das für einen abendfüllenden Dokumentarfilm?
Bitomsky, der nach einigen Jahren an der Hochschule CalArts in Kalifornien nach Deutschland zurückgekehrt ist und nun die Berliner Filmhochschule dffb leitet, zeigt, dass gerade ein unvermutetes oder vernachlässigtes, ein übersehenes Sujet bestens eine ganze Welt aufschließen kann. Zwar sind die Beobachtungen, die er für "Staub" auf einer Reise quer durch Deutschland einsammelt, nicht so spektakulär wie der Sandsturm aus "The Wind" von Victor Sjöström, der den filmgeschichtlichen Bezugspunkt setzt. Dafür aber entdeckt Bitomsky in der vermeintlich zunehmend immateriell werdenden Ökonomie eine Gegenständlichkeit, die zwischen Rohstoffwirtschaft und Nanotechnologie eine beinahe ironische Zwischenstellung einnimmt.
Die langwierige Prozedur, in der sich ein Facharbeiter ankleidet, der in einem Reinraum tätig ist, erinnert nicht von ungefähr an die Vorbereitung eines Raumfahrers, der in den luftleeren Raum hinausgehen muss. "Staub" grenzt nicht nur an dieser Stelle an Science-Fiction, bleibt dabei aber konsequent auf der Seite des Faktischen. Manchmal setzt Bitomsky sich bewusst dem Risiko aus, mit dem Schulfernsehen verwechselbar zu werden - im Grunde ist die Sache nämlich umgekehrt, durch einen Film wie "Staub" wird das, was als Industrie- oder Bildungsfilm die längste Zeit aus der Filmgeschichte ausgeschlossen war, mit dem geläufigen Kino verbunden. Wie ein Filter zur Messung der Luftqualität funktioniert oder wie Goldstaub gesammelt und eingeschmolzen wird, das gehört auf eine Ebene mit dem Sternenstaub, der durch die kosmische Imagination weht (und bei Bitomsky auch Gegenstand einer profund naturwissenschaftlichen Analyse wird).
Natürlich gibt es auch in Deutschland noch die Bergwerke und Abraumhalden, die "Staub" auf die Ebene der alltäglichen, sichtbaren Welt zurückholen. Die meiste Zeit aber geht Bitomsky an die Grenzen des Anschaulichen. Er entdeckt dabei nicht nur eine ganze Reihe auskunftswilliger Wissenschaftler, sondern vermittelt auch einen Begriff von der Spezialisierung deutscher Ingenieurskunst - das Kino achtet ja selten darauf, wo der Wohlstand dieses Landes erwirtschaftet wird. "Staub" hingegen kommt, gerade weil es um einen schwierigen Stoff geht, fast von selbst zur Spitzentechnologie.
Bei einer Premiere des Films hat Bitomsky davon erzählt, dass das Projekt schon in einer amerikanischen Version existierte. Man kann sich den entsprechenden Film ganz gut vorstellen - er wäre vermutlich ein wenig "mythologischer" geworden, näher dran an der Natur, so wie Silicon Valley näher an einer richtigen Wüste liegt.
"Staub" enthält davon noch einen Rest, einige fotografische Dokumente von den Staubstürmen in den Vereinigten Staaten, die als Folge der Intensivlandwirtschaft zu Hungersnöten und Landflucht von Texas bis Oklahoma führten. Das mittelgebirgige Deutschland kennt derlei Katastrophen nicht. Aber auch hier landet immer wieder Staub aus der Sahara, und wer dies - nach "Staub" - weiß, wird ganz neue Facetten der Globalisierung entdecken.
BERT REBHANDL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
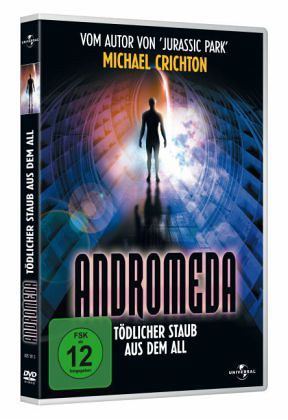





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.02.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.02.2008