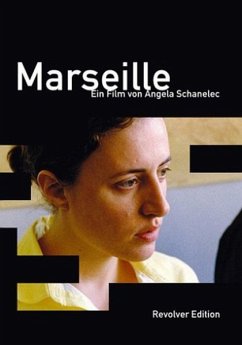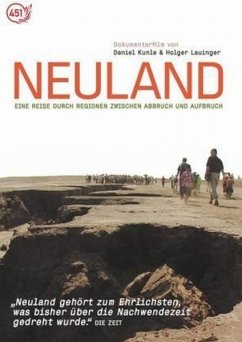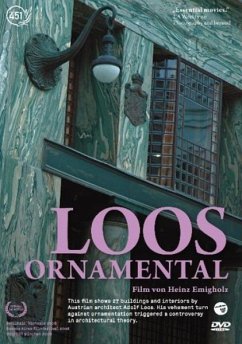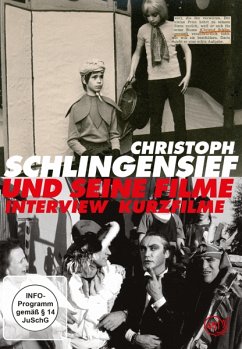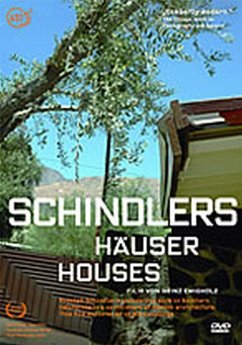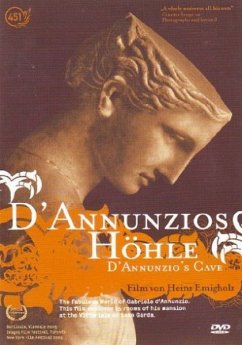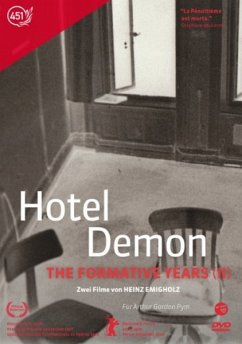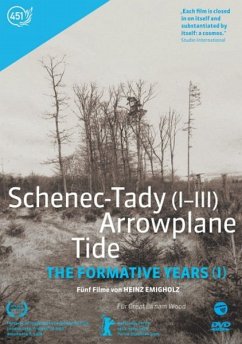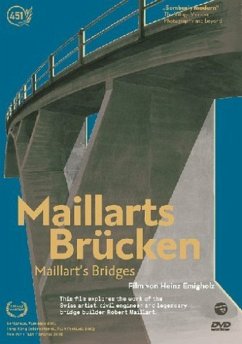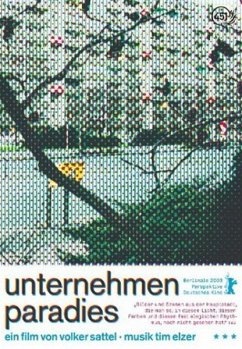Kindheit jener Generation, die heute an vielen Entscheidungspositionen dieser Welt sitzt.
Es sind Kinder der sechziger Jahre, die 1979 in einem kleinen Ort in Ohio einen Film drehen wollen. Es soll, weil nur Jungs dabei sind, ein Schocker werden. Doch der als Regisseur ausersehene Joel bringt dann überraschend ein Mädchen mit - er hat schon mitbekommen, dass nicht nur "production values" wichtig sind, sondern auch ein "love interest". Nicht ganz zufällig ist Alice (Elle Fanning) das Mädchen, an dem er selbst ein "Liebesinteresse" hat. Alice lässt sich zuerst nur zögernd auf das Abenteuer ein, sie ist eigentlich schon zu groß dafür, aber Abrams lässt uns keinen Moment im Zweifel, dass sie den Moment noch nicht erlebt hat - das Ende ihrer Kindheit steht aber knapp bevor.
Der eigentliche Held unter den Jungen ist nicht der dickliche Joel, sondern Kyle (Jackson Lamb), ein Halbwaise, der seinem Vater dabei zusieht, wie der mit seiner Trauer nicht zurechtkommt, und deswegen mit der eigenen allein bleibt. Auch Alice lebt nur mit ihrem Vater, einem rüden Gesellen, der zu Beginn des Films bei der Trauerfeier für Kyles Mutter abgeführt wird - beide Kinder sind deutlich füreinander bestimmt, obwohl der Altersunterschied beträchtlich ist.
Bei nächtlichen Dreharbeiten zu einer Abschiedsszene werden die Kinder Zeugen eines Unglücks: Ein Zug entgleist und hinterlässt eine apokalyptische Landschaft. Dass es mit dieser Katastrophe eine besondere Bewandtnis haben muss, wird schnell klar, und die Bewohner des Ortes werden durch eine Reihe unerklärlicher Vorfälle darauf verwiesen, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.
Geschickt vermittelt Abrams zwischen der Perspektive der Kinder (die den Vorteil haben, dass sie - als Filmemacher - alles für möglich halten) und dem vernünftigen Protokoll der Erwachsenenwelt, das hier in zweifacher Hinsicht am eigentlichen Ereignis vorbeizielt: Die einen wollen nicht sehen, was die anderen unbedingt vertuschen wollen. Es befindet sich nämlich ein Alien in der Gegend, das dringend nach Hause will, und nur ein Kind wird unerschrocken genug sein, dem Monster so in die Augen und den Rachen zu sehen, dass es diesen Wunsch erkennen kann.
Als Produzent von "Super 8" fungiert Steven Spielberg, auf dessen Werdegang die Geschichte direkt verweist. Der zwei Jahrzehnte jüngere Abrams entbietet dem Meister des amerikanischen Erzählkinos seinen Respekt, und er tut dies auf eine Weise, die hart an Mimikry grenzt. Doch das würde dem Film nicht gerecht. "Super 8" konstruiert einen Zusammenhang zwischen medialer und generationeller Unschuld. Abrams suggeriert, dass es gerade das Filmmaterial der Amateure ist, das jenen Umschlag ermöglicht, der immer schon der eigentliche Triumph des Filmischen war: dass wir außergewöhnliche Situationen daran messen, dass sie "wie im Kino" sind, und dass das Kino daran zu messen ist, dass es für diese Situationen zuständig ist.
"Super 8" konstruiert eine Kindheitsgeschichte der heutigen, hoffnungslos entgrenzten Medienwelt, psychoanalytisch gesprochen: eine kollektive Deckerinnerung über all das, was Abrams in seiner Ergebenheitsadresse an das große Vorbild Spielberg an Eigensinn nicht zulassen kann. Eine nostalgische Hommage, die in ihrer Perfektion auch irgendwie beängstigend ist.
BERT REBHANDL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
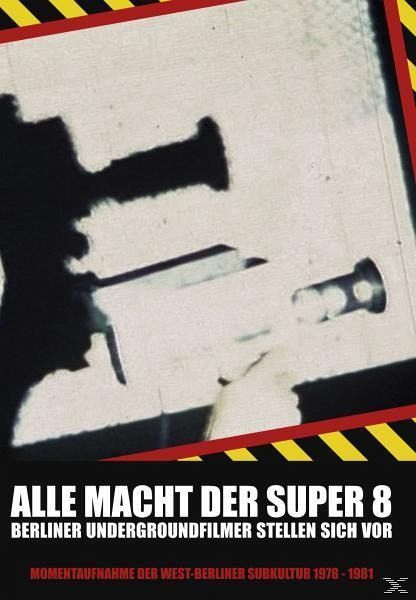





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.08.2011
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.08.2011