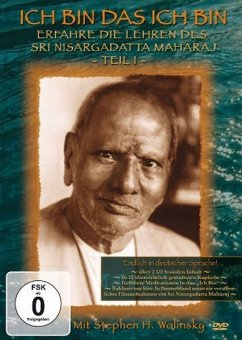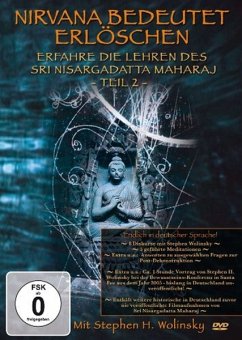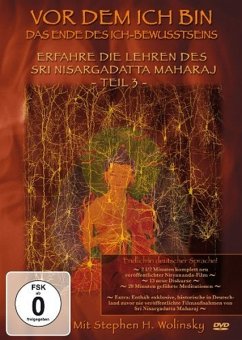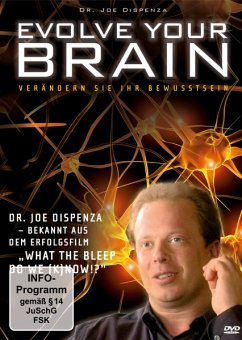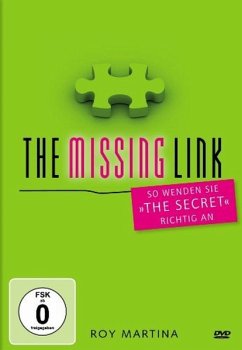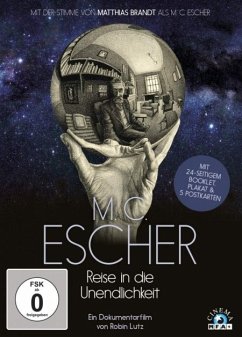der ideologischen Antike" angeschaut, Kluges Montagefilm über "Das Kapital" von Marx nach einer Idee von Eisenstein. Und nun vernehmen sie den Autor selbst, der allerdings nicht leibhaftig vor ihnen sitzt, sondern von der Projektionsfläche einer digitalen Konferenzschaltung aus einem Münchner Büro mit ihnen redet.
Die mediale Indirektheit mindert merkwürdigerweise die Gegenwärtigkeit des Ereignisses nicht, sondern fügt ihr eine weitere Ebene hinzu: Der enthusiastische weißhaarige Mann, der da sieben Stunden Zeitunterschied entfernt an einem Tisch mit Papieren und Selterswasserflaschen sitzt, wird durch das leicht überbelichtete Übertragungsbild in Peking selbst zur Nachricht aus einer Art Antike, zur Erscheinung aus einer anderen historischen Sphäre mit lang zurückreichenden Wurzeln. Kluges Vorstellung einer ständigen Metamorphose und Wiederkehr der geschichtlichen Bestände begegnet da dem aktuellen Interesse des chinesischen Publikums, mit Hilfe der fremden Perspektive Marx wieder zum Tanzen zu bringen.
Kluges im Auftrag des Suhrkamp-Verlags 2008 gedrehter Marx-Film ist in chinesischen Künstlerkreisen schon seit Jahren ein elektrisierendes Gerücht. Auf Anregung von Kuratoren des Pekinger Iberia Center for Contemporary Art hat das Goethe-Institut den Film nun untertiteln lassen und zeigt ihn im Lauf der kommenden Woche an mehreren Orten in Peking, begleitet von Diskussionen über Kluges Montagetechnik und über die Aktualität der Kapitalismuskritik. An der Kunsthochschule von Hangzhou wollen dann kommende Woche vor dem Hintergrund des laufenden Films chinesische und europäische Künstler und Intellektuelle wie Gao Shiming, Boris Groys, Wang Jianwei, Yang Fudong und Zhang Peili in Interviews, Erklärungen und eigenen Werken die im Film berührten Motive für einen neuen Digitalfilm bearbeiten.
Kluges Marx-Projekt wird also in China fortgesetzt. Es gebe innerhalb der großen Menschheitsgeschichte Geschichten der Unterdrückung und der Emanzipation etwa zu gleichen Teilen, sagte Kluge. Eine ungeahnte List der Geschichte scheint es zu fügen, dass Marx ebendort, wo er Formeln zur Unterdrückung bereitstellte, nun auch als potentielles Medium einer künstlerischen und intellektuellen Befreiung gefragt ist, gerade unter jüngeren Leuten. Dass es bei Kluge um keine orthodoxe Marx-Exegese und noch nicht einmal um einschlägig marxistische Themen ging, schien die Attraktivität des Unterfangens eher noch zu steigern.
Wie im Film ließ Kluge auch von seinem Projektionsbild aus keinen Zweifel daran, dass ihn weniger die Politik und Ökonomie im engeren Sinn interessierten als deren Spiegelung in den vielen einzelnen, miteinander verflochtenen Lebensgeschichten; er nimmt Marx als Dichter. "Alle Dinge sind verzauberte Menschen", zitierte er ihn; in jedes einzelne gingen Lebenszeit, Erfahrung, geglückte oder gescheiterte Kooperation ein, und im Fall des Scheiterns würden die Dinge "krumm und schief und unsere Tyrannen" - etwa wenn es sich um Institutionen und Gesetze handelt. Keine Regierung könne dann verhindern, sagte Kluge mit "unserem Chinesen in Königsberg" (Kant), dass sich die Menschen dagegen auflehnten. Kluges Gesprächspartner war der Pekinger Ideenhistoriker Wang Hui, der in China der Neuen Linken zugerechnet wird. Er stellte dem Konzept der Dinge als Spiegelungen des Menschen die dem taoistischen Denker Zhuangzi entlehnte Vorstellung einer universellen, den Menschen einschließenden "Gleichheit der Dinge" gegenüber, die verlange, alle geläufigen Zuschreibungen und Benennungen in Frage zu stellen.
Dieser Devise scheint nun auch die neue Art Kapitalschulung zu folgen, so dass der Boden etwas schwankt. Bei einer zum Kluge-Komplex gehörenden Debatte über die "globalen Verhältnisse" rief ein Student begeistert: "Wir müssen im Denken zu Konfuzius und in der Ökonomie zu Marx zurückkehren!" In solchem diskursiven Zwielicht fühlen sich die staatlichen Zensoren offenbar überfordert; sie teilten mit, es fehle ihnen an Zeit zur Prüfung, und deshalb wird die Theaterverarbeitung des "Kapitals" von Rimini Protokoll, die fürs Wochenende vorgesehen war, jetzt erst einmal verschoben.
Für Kluge scheint sich China in sein Schema der ewigen Verwandlungen zu fügen. "Nichts geht unter", insistierte er. "Es geht für einen Moment unter, und dann taucht es an anderer Stelle wieder auf." Er bezeichnete es als "guten Zufall oder guten Instinkt", dass der stellvertretende Präsident Chinas in Europa vor kurzem Irland besuchte, ein vergleichsweise armes Land, in dem Mönche im Mittelalter die Antike von der Peripherie her wieder ins Spiel brachten: "Das sind die besten Geschichten des Abendlands." Doch die Zivilisation sei ja zweimal entstanden, im Westen und im Osten. Kluge kündigte an, in seinem dtcp-Fernsehprogramm demnächst China näher untersuchen zu wollen.
MARK SIEMONS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
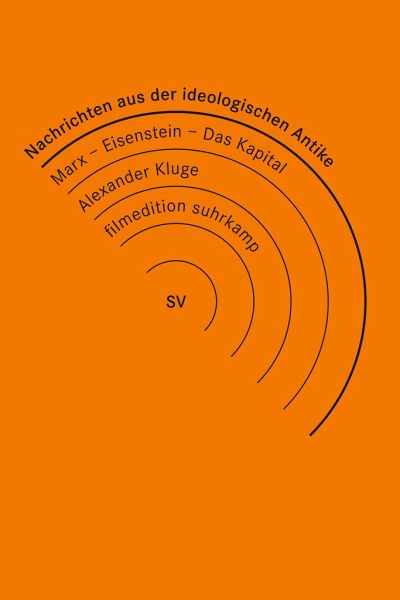





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.03.2012
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.03.2012