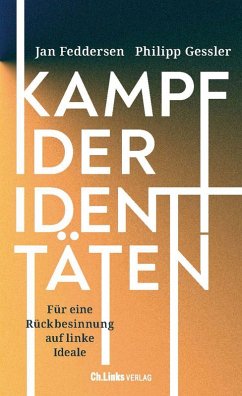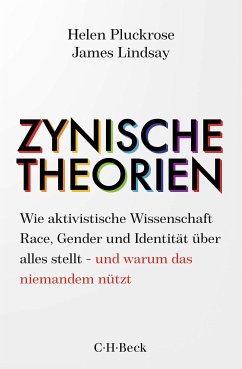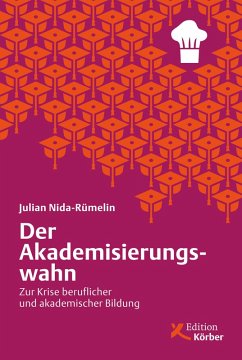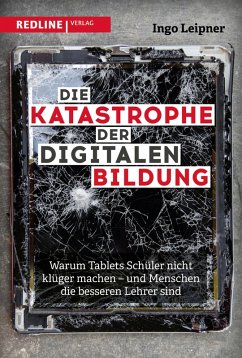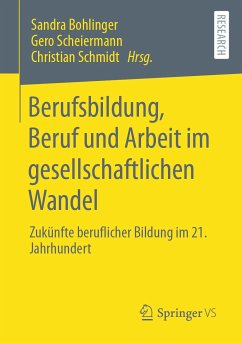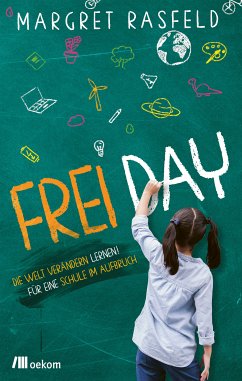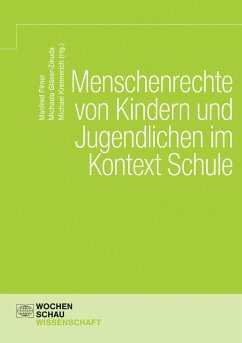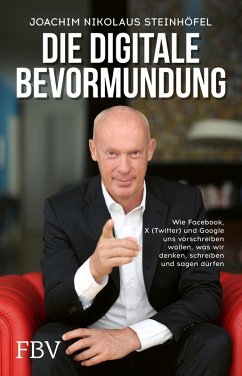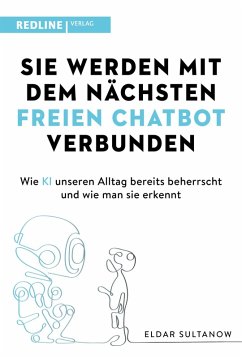ist ein zweites großes Rätsel, warum diese abenteuerliche Vorstellung ausgerechnet an den Universitäten ausgebrütet worden ist, die als wissenschaftliche Institutionen Hypothesen an der Empirie messen sollten; und es ist ein drittes großes Rätsel, warum diese Sicht von weiten Teilen der Gesellschaft zwar nicht geschätzt, aber geduldet wird, sodass sie in immer weitere Bereiche vordringen und zur dominanten politischen Ideologie unserer Zeit werden konnte. Gar nicht mehr zu erklären, sondern einfach nur absurd ist vor diesem Hintergrund, dass Millionen von Menschen ausgerechnet in diese Länder fliehen, wo sie angeblich pausenlos schikaniert werden. Sollte man sie nicht warnen?
Die neue Ideologie des schlechten Gewissens nennt sich "angewandter Postmodernismus" und ist schon oft totgesagt worden, weil sie, vorsichtig gesagt, ein schwieriges Verhältnis zur empirischen Wirklichkeit unterhält. Doch trotz aller Einbrüche des Realen steht sie heute in vollster Blüte, ja, es gab noch nie eine Zeit, die so postmodern wie die unsere war. Nach der britischen Publizistin Helen Pluckrose und dem amerikanischen Mathematikprofessor James Lindsay frisst die postmoderne Bewegung, je weiter sie in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft vordringt - und das tut sie derzeit in atemberaubendem Tempo -, das Fundament der liberaldemokratischen Gesellschaft an, indem sie Institutionen aushöhlt und ihnen ihre Dogmen überstülpt. Ihr Buch mit dem treffenden Titel "Zynische Theorien" (Verlag C. H. Beck, 2022) ist die bislang wohl profundeste Analyse des angewandten Postmodernismus und seiner Wandlungen.
Es ist viel darüber diskutiert worden, inwieweit die Granden der französischen Theorie wie Michel Foucault und Jacques Derrida für die heutigen identitätspolitischen Verwerfungen verantwortlich gemacht werden können. Pluckrose und Lindsay umschiffen die Untiefen dieser Debatte, indem sie die postmoderne Theorie auf sechs Prinzipien bringen, die überwiegend auf Foucault oder Derrida zurückgehen und die sich in allen späteren Strömungen unter veränderter Zielsetzung teilweise oder vollständig wiederfinden: die Behauptung, alles sei soziales Konstrukt; Objektivität und Wahrheit seien nur Masken einer unterschwellig wirkenden Macht, die alles durchdringe und sich in der Sprache manifestiere; die von Derrida stammende krude These, Sprache beziehe sich auf keinerlei Wirklichkeit außer ihrer selbst. Dazu kommen die Ablehnung von Individualismus und Universalismus sowie eine regelrechte Manie, alle Begriffe und Grenzen zu verwischen. Feindbild Nummer eins ist die Wissenschaft, die, ein von Foucault vererbter Gedanke, vor allem westlichen Machtinteressen und nie allein der Erkenntnis diene. Zur Strafe soll sie in eine Art narrativer Gruppentherapie umgewandelt werden, in der es vor allem auf authentische Erfahrungen ankommt.
Das ist im Ansatz nicht einmal falsch. Tatsächlich ist die Wissenschaft auch ein Ausschlusssystem, das für Gefühle, Deutungen und bestimmte Wahrnehmungstypen kein Organ hat. Diese Einsicht wird aber gleich wieder dadurch verspielt, dass man im Rausch des Hybriden alle Unterschiede zwischen Verstand und Gefühl, Urteil und Meinung, praktischem und theoretischem Wissen und besonders, in der Folge von Foucault, Deutung und Wissen einebnet. Es gibt nun keine Möglichkeit mehr, verschiedene Erkenntnisbereiche auszuweisen, zwischen Philosophie und Maschinenbau zu unterscheiden, was aber auch gar nicht zu dem Bestreben passen würde, jede Vernunfteinsicht der gelebten Erfahrung unterzuordnen.
Es ist ersichtlich, dass eine Theorie, die aller Vernunft den Laufpass gibt, ihre Gegner nur niederschreien kann. Nicht verwunderlich ist auch der fehlende Sinn für Empirie. Wo subjektive Meinungen auf eine Stufe gestellt werden mit methodisch gewonnener Erkenntnis und ohnehin alles nur Worte sind, braucht man sie nicht mehr. Diese Entwicklung kann man Foucault und Derrida nur noch bedingt in die Schuhe schieben. Was den französischen Postmodernismus der Sechziger- und Siebzigerjahre von seinen identitätspolitischen Nachfahren unterscheidet, ist die Erkenntnishaltung. War die französische Urfassung, wie Pluckrose und Lindsay schreiben, eine im spielerischen Gestus nihilistischer Verzweiflung vorgetragene Erkenntniskritik, die nicht an grundlegende politische Veränderung glaubte, so stellen sie die auf ihn aufbauenden Bewegungen - postkoloniale Theorie, Queer-Theorie, Critical Race Theory und Gendertheorie - seit den Neunzigerjahren vom Kopf auf die Füße.
Man will die Welt nun nicht mehr nur dekonstruieren, sondern verändern. Der französische Dekonstruktivismus verkehrt sich, mit Opferansprüchen aufgeladen, in einen kruden Identitätskult. Auch dafür hat Derrida mit seinem Theorem des taktischen Essentialismus die Grundlagen gelegt, kurz gefasst: Opfer dürfen schmutzige Tricks anwenden, die vermeintlich Mächtigen nicht. Damit entbrennt der Kampf um den maximalen Opferstatus, der, je mehr Opfermerkmale reklamiert werden, zu einem einzigen Hauen und Stechen wird. Niemand darf sich sicher fühlen. Das erfuhren die muslimischen Mitarbeiterinnen eines kanadischen Beauty-Shops, die sich aus religiösen Gründen weigerten, einer Transperson das Genital zu enthaaren, und dafür öffentlich als transphob angefeindet wurden.
In den Nullerjahren und vollends seit 2010 schlugen diese Bewegungen nach Pluckrose und Lindsay in den verdinglichten Postmodernismus um. Die zentralen Prämissen werden nun als absolute Wahrheiten gehandelt und Widerspruch mit Exkommunikation bestraft. Man hat es mit der vollendeten Paradoxie einer Theorie zu tun, die jede Wahrheit bestreitet, aber steif und fest behauptet, selbst im Besitz der absoluten Wahrheit zu sein. Die Kulturkämpfe um Mikroaggressionen oder Safe Spaces sind deshalb nicht, wie oft gesagt wird, ein aus dem Ruder gelaufener Aktivismus, sondern logischer Ausfluss einer zum Dogma geronnenen Theorie, die ihre Gegner vernichten will.
Menschen werden jetzt wieder nach Hautfarben sortiert, weniger pigmentierten Zeitgenossen wird gesagt, sie seien von Grund auf rassistisch und können sich, egal wie sie sich verhalten, nie von diesem Fluch befreien. Weißen Obdachlosen wird gepredigt, sie gehörten zu einer privilegierten Unterdrückerkaste. Schädlich ist der postmoderne Aktivismus auch für seine Mandanten. Entwicklungsländer haben nichts davon, wenn sie vom technischen Fortschritt ausgeschlossen bleiben und ihre Bürger als vernunftunfähige Wesen abqualifiziert werden. Freuen dürfen sich die dortigen Diktatoren, die kein weißer Mensch mehr kritisieren darf.
Pluckrose und Lindsay erinnern daran, dass all diese Strömungen einmal auf liberale Beweggründe zurückgingen, bis sie durch den postmodernen Einfluss eine zynische Schlagseite bekamen. Besonders deutlich wird dies, wenn in den Fat Studies, einem neueren Zweig der postmodernen Theorie, übergewichtigen Menschen geraten wird, medizinische Warnungen vor Herzerkrankungen oder Gelenkverschleiß in den Wind zu schlagen und ihren Körper so zu feiern, wie er ist; oder wenn Behinderten, die sich wünschen, nicht mehr behindert zu sein, von Vertretern der Disability Studies vorgehalten wird, sich der verhassten Norm zu unterwerfen.
Natürlich läuft die pauschale Anfeindung der Wissenschaft unter der Prämisse, dass die exakten Disziplinen ihre Arbeit schon machen, bessere Medikamente und, ganz wichtig, neue Gadgets bereitstellen, auf denen Andersdenkende denunziert werden können; die Wissenschaftler müssen sich währenddessen nur als schlechte oder, wie José Medina schreibt, "epistemisch verdorbene" Menschen fühlen, die einem im Prinzip verwerflichen Tun nachgehen. Es ist erstaunlich, wie wenig Widerstand die Universitäten und andere Institutionen einer Bewegung leisten, die ihre Existenzbedingungen negiert und über immer mehr Funktionsstellen zu einer milliardenschweren Verhaltensindustrie aufgebaut wird. Letztlich ist der angewandte Postmodernismus die Aufkündigung des Konsensprinzips zugunsten des böswilligen Verdachts und der kleinlichen Beschwerde. Wer nicht morgen in einer solchen Gesellschaft leben will, muss sich heute dagegen wehren. THOMAS THIEL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
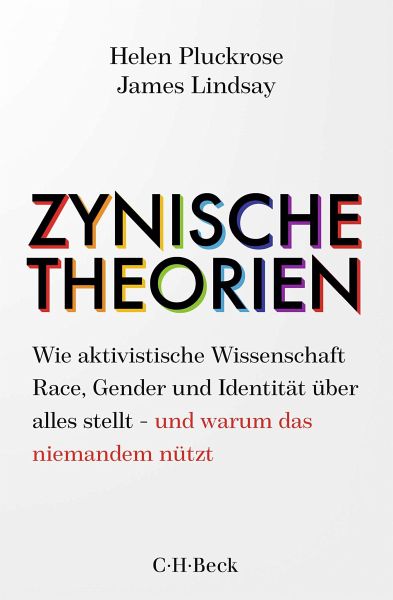





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.03.2022
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.03.2022