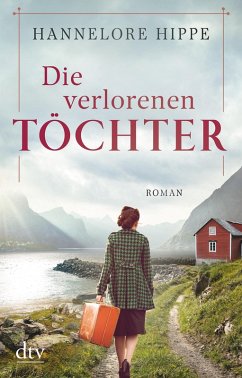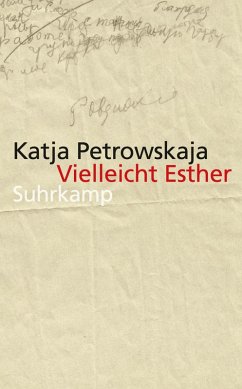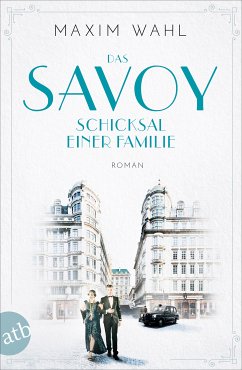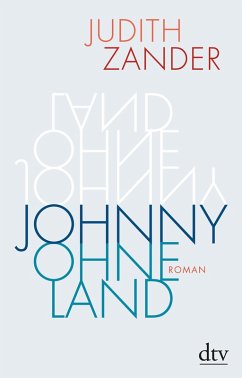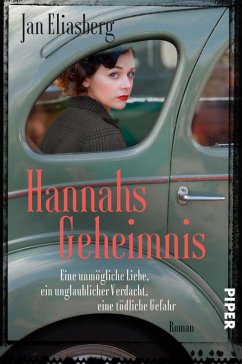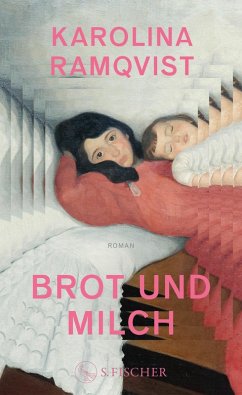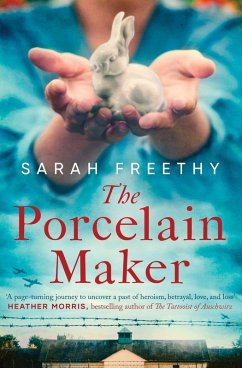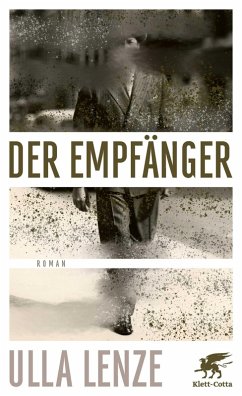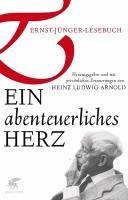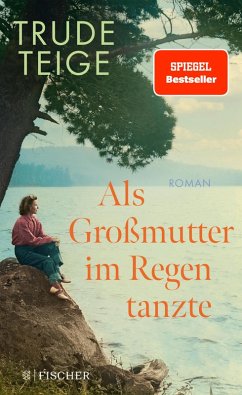familientauglichen Erinnern, in dem alle erst einmal Opfer sind - diejenigen, die Krieg, Flucht und "Frau, komm!" selbst miterlebt haben, ebenso wie wir Nachgeborenen.
Wildenhains Verdienst in diesem Roman besteht geradezu darin, für diesen Diskurs die passende narrative Strategie gefunden zu haben: die gute alte Verschränkung der Zeitebenen. Mama mußte vor den Russen fliehen, und "das Weinen, Aufrappeln, Hochhasten, das Fassen bei den Händen, das Laufen und Laufen und Laufen, das erneute Stolpern und Stürzen, die verschmierten Handflächen und Knie, Kuhlen, Furchen, Hindernisse" und so weiter - war es nicht ungefähr das gleiche damals im Flüchtlingstreck wie heute beim Weglaufen vor den großen Jungs, die immer die Indianerfiguren klauen und einen beim Fußball nicht mitmachen lassen?
Mit sicherem Griff findet Wildenhain auch die Erzählinstanz, der man solche doch etwas kruden Engführungen am ehesten abnimmt: einen kindlich-jugendlichen Ich-Erzähler, der den vollen Ernst dessen, was er von der Elterngeneration aufschnappt, noch nicht realisiert ("Was mit dem Osten, glaube ich. Irgendwas mit unserer Familie") - im Gegensatz zum erwachsenen Leser, der überall gnadenlos ins Verstehen gezwungen wird. Die Grundfigur des Romans ist demnach eine Art halbaufgeklärter Voyeurismus. Eine Belauschungs- und Beobachtungsszene folgt der anderen: vor der Schlafzimmertür der Eltern, im Krankenhaus, im Baum vor dem Fenster der Liebeslaube, versteckt im Wald, auf dem Heuboden über Oma und den Russen und immer wieder bei hinterrücks belauschten Gesprächsfetzen im Familienkreis. All dies verdichtet sich, ergänzt durch das obligatorisch rätselhafte Kinderfoto in Schwarzweiß zum schwerwiegenden Geheimnis der Vergangenheit.
Als der Junge größer wird, will er mehr über die verdrängten Familiengeschichten erfahren und beginnt endlich nachzufragen. Aber auch die längeren Erzählpassagen, die daraufhin der Mutter, Tante Trautchen und Günni, dem mysteriös-inzestuösen Halbonkel von drüben, eingeräumt werden, ja selbst die mißglückten Kurzgeschichten des Vaters, die ein sinistrer Verleger stückweise rausrückt, ändern an der narrativen Grundsituation nichts - auch sie drehen sich im Kern stets um heimliche, halbverstandene Beobachtungen. Der Voyeurismus ist die Bedingung der Möglichkeit dieses Erzählens; seine konsequente Erfüllung findet er in der (ansonsten nicht weiter hinderlichen) Persönlichkeitsspaltung des Erzählers: "Früher war es mir möglich, an mich selbst als einen Fremden zu denken. Ich dachte an mich in der dritten Person." So "konnte ich einem Jungen zuschauen, der vom Spiel der anderen ausgeschlossen blieb". Und wir dürfen durch die Erzählung daran teilhaben.
Nun hat man das, was da erschaut und erlauscht wird, alles schon ein paarmal gelesen: die zertretene Brille, der zerbrochene Fotorahmen, das vor den Rüpeln gerettete Vögelein, die gefährlichen Bahndämme, die Brennesseln und die frühreifen Spiele im zerstörten Bunker (unmittelbar vor der Entjungferung zerbricht natürlich der Talisman des toten Vaters!). Diese Versatzstücke des Traumatischen werden bei Wildenhain mit Bedeutsamkeit aufgeladen durch die reale oder assoziative Verschränkung mit den Kriegstraumata, die auf allen Ebenen für das verstörte oder verhärtete Gebaren der Elterngeneration verantwortlich sind. ",Warum ist er Chef?', hatte ich meinen Vater gefragt, als uns sein Vorgesetzter, Herr Berg, zu Hause besucht hatte. ,Weil er', hatte mein Vater gesagt, ,weniger lange im Krieg war.'" Mit Großvater, der lieber in seiner Ostlaube bleibt, kann man Pferde stehlen und "Je t'aime" hören - die lustige Paech-Brot-Werbung geht auch nur mit Omama und Opapa. Mutter Inka aber, heute streng, früher fidel, wird bei erster Gelegenheit die frivole Platte zerbrechen. Der Rauch ihrer Generation steigt nicht mehr nach oben, während die Erinnerungen allmählich aus dem sorgfältig geführten Haushaltsbuch eliminiert werden. Wenn ganz am Ende dann auch das letzte Geheimnis um die Mutter noch in einer Szene vom Trauma der jüngeren deutschen Vergangenheit seine Erklärung findet, ist das Schema schon so vertraut, daß man das kaum noch als spektakulär empfinden mag.
Ganz ähnlich wie "Russisch Brot" ist ein Roman von Annett Gröschner betitelt, der vor einigen Jahren erschien: "Moskauer Eis". Hier war die Verschränkung von Familien- und Nachkriegsgeschichte gelungen, weil Gröschner das Private in einer Geschichte der DDR-Kältetechnik zu objektivieren vermochte und umgekehrt. Es geht also. Wo jedoch die historisch-familiäre Erinnerung statt dessen einem zweifelhaften Fabulieren anvertraut wird, mit bösen Russen und Grenzposten einerseits, Inzest, Verrat und Schuldverstrickung andererseits, begibt sich die Literatur auf dubioses Terrain. Zu Unterhaltungszwecken überläßt man so etwas lieber anderen. Wer sich dagegen ernsthaft für die Traumata der Vergangenheit interessiert, der greife zu Kempowskis "Echolot".
Michael Wildenhain: "Russisch Brot". Roman. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2005. 271 S., geb., 18,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
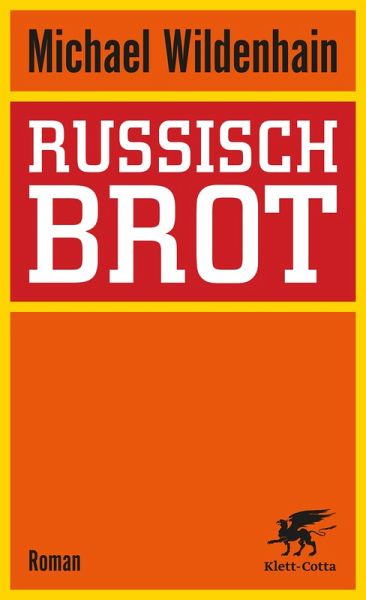





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.03.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.03.2005