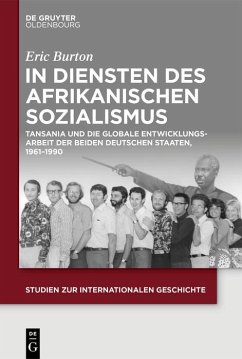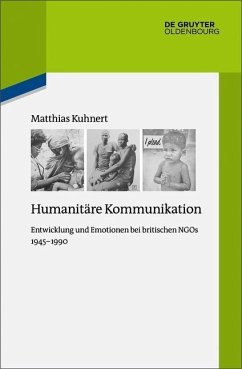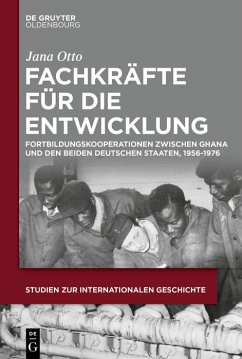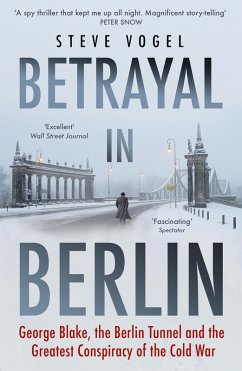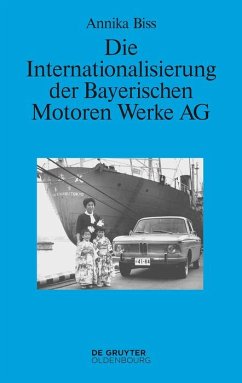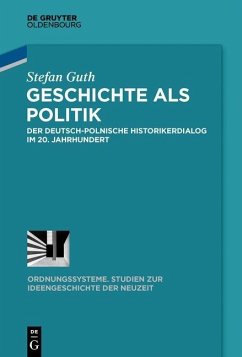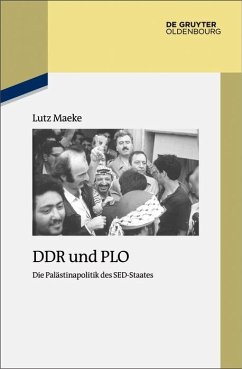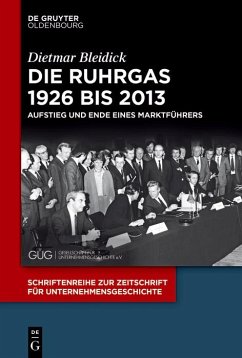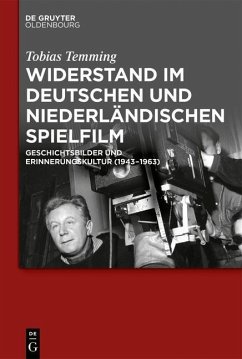Burton zeichnet die entwicklungspolitischen Beziehungen zwischen Westdeutschland und Tansania einerseits sowie zwischen der DDR und Tansania anderseits über drei Jahrzehnte bis zur Wiedervereinigung Deutschlands 1990 nach. Besonderes Augenmerk gilt dem Spannungsverhältnis zwischen Kaltem Krieg, Dekolonisierung und konkurrierenden Sozialismen.
Tansania erklärte 1961 seine Unabhängigkeit von Großbritannien. Mit der Deklaration von Arusha sechs Jahre später wurde Ujamaa - als eine Variante des afrikanischen Sozialismus - unter dem ersten Präsidenten Tansanias, Julius Nyerere, Staatsdoktrin. Unter dem Primat der Blockfreiheit ging Ujamaa auf Distanz zu der Sowjetunion und dem doktrinären Marxismus-Leninismus. Mit ihrer Betonung der Self-reliance - auf Deutsch etwa Selbständigkeit - war die Deklaration von Arusha zudem eine Reaktion auf außenpolitische Krisen direkt nach der Unabhängigkeit. Bundesrepublik, USA und Großbritannien froren Mitte der 1960er Jahre zahlreiche Entwicklungsgelder ein.
Doch schon Anfang der 1970er Jahre galt Tansania als Schwerpunktland sowohl für westdeutsche "Entwicklungshilfe" als auch für ostdeutsche "sozialistische Hilfe". Nyerere setzte beim Aufbau eines eigenständigen afrikanischen Sozialismus auf Expertise, Kredite und Stipendien aus Ost und West - was durchaus Gegenstand von Kritik war. Studierende der Universität Daressalam fragten etwa bei einer Demonstration gegen die Privilegien politischer Eliten: "Seit wann sind Kapitalisten in der Lage gewesen, den Sozialismus aufzubauen?"
Tansania war sowohl für die DDR als auch für die Bundesrepublik von geostrategischer und regionaler Bedeutung. Das entwicklungspolitische Engagement verlief laut Burton in vier Phasen. Die erste, bis 1964, stand noch im Zeichen der Dekolonisierung. In der zweiten, bis 1970, führte die deutschlandpolitische Konkurrenz zu einer deutlichen Politisierung der Entwicklungszusammenarbeit. Die DDR war in Sansibar so aktiv und präsent wie nie zuvor oder danach in einem Land, während der Widerstand Nyereres gegen "eine politische Instrumentalisierung von ,Hilfe'" die Beziehung zwischen der Bundesrepublik und Tansania vorübergehend schwächte.
In der Phase der friedlichen Koexistenz zwischen 1970 und 1977 verfolgte die DDR ihre politischen Interessen vor allem durch die Entsendung von Personal, während die Bundesrepublik zahlreiche Großprojekte förderte. Der Preis war eine höhere Abhängigkeit und Verschuldung Tansanias. Bis 1990 dann verfolgte die DDR in erster Linie wirtschaftliche Interessen, während die Bundesregierung ihre antikommunistische Rhetorik wiederbelebte.
Neben den Regierungen stehen als Akteure im Zentrum der Monographie - und das ist eine ihrer Stärken - das entsandte Entwicklungspersonal sowie Studierende. Was waren ihre Motive, Zukunftsvorstellungen und Lebensbedingungen? Welche politischen Visionen spielten für die Akteure eine Rolle? Wie beeinflussten konkurrierende Entwicklungskonzepte und ideologische Vorgaben die Arbeit in der Praxis? Waren die nach Tansania Entsandten gar "trojanische Pferde"?
Zur Beantwortung dieser Fragen stützt sich Burton sowohl auf Privatarchive ehemaliger Gesandter als auch auf offizielle Quellen beider deutscher Staaten und Tansanias, wobei er die Bestände dort - nicht selten bei postkolonialen Staaten - als "dispersed, destroyed, fragmented, and accidental" charakterisiert. Er greift unter anderem auf offizielle Berichte sowie halboffiziellen und privaten Schriftwechsel zurück, auf Autobiographien und Erfahrungsberichte.
Mehr als 100 Interviews führte Burton zudem mit Entwicklungspersonal aus der Bundesrepublik und der DDR, mit deren tansanischen Partnern in der Bürokratie und Fahrern im Dienste der GTZ, mit ehemaligen Diplomaten, Verwaltungskräften und tansanischen Studierenden, die in beiden oder einem der deutschen Staaten Hochschulen besucht haben.
Die Quellen sind beeindruckend umfangreich. Burton gelingt damit ein detailliertes Bild der Entwicklungszusammenarbeit beider deutscher Staaten mit Tansania. Er zeigt, wie Visionen sich immer mehr dem Primat ökonomischer Krisenbewältigung unterordneten und das Ideal der Self-reliance wachsender Abhängigkeit wich. Visionen treffen auf Desillusion, Idealismus auf Pragmatismus, Erfolge auf Misserfolge, politische Vorgaben auf praktische Schwierigkeiten.
Exemplarisch herausgegriffen sei an dieser Stelle der Hochschulsektor, an dem der Autor einerseits die tansanische Strategie zeigt, entwicklungspolitische Angebote pragmatisch zu nutzen. Andererseits erhofften sich sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR - auch das exemplarisch - von dem Wissenstransfer politischen und ökonomischen Nutzen. Beide Staaten wollten Fach- und Führungskräfte ausbilden in der Hoffnung, dass diese sich politisch nach dem jeweiligen Land orientieren würden. Während die Bundesrepublik mit der Ausbildung an deutschen Maschinen den eigenen Export anzukurbeln plante, hoffte die DDR, die Studierenden würden sich an ihre Zeit im Land erinnern, wenn sie "Prospekte westdeutscher Firmen in den Händen" hielten.
Doch der zu Beginn zitierte paradoxe Ideologisierungseffekt zeigt, wie falsch die Annahme war, dass "die ideologische Gunst auf jene Seite fallen würde, wo auch das Studium stattgefunden hatte". Erfahrungen vor Ort konnten durchaus, wenn auch nicht immer, zu gegenteiligen Effekten führen: Im Osten konnten die Studierenden aufgrund von Mangelwirtschaft und zum Teil ungewohnter Reisefreiheit unternehmerische Energie entwickeln, während etwa in den USA Obdachlosigkeit ein Schlaglicht auf die soziale Ungleichheit warf - die ja mit Ujamaa überwunden werden sollte.
TATJANA HEID
Eric Burton: In Diensten des afrikanischen Sozialismus. Tansania und die globale Entwicklungsarbeit der beiden deutschen Staaten, 1961-1990.
De Gruyter Oldenbourg Verlag, Berlin 2021. 607 S., 69,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.07.2021
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.07.2021