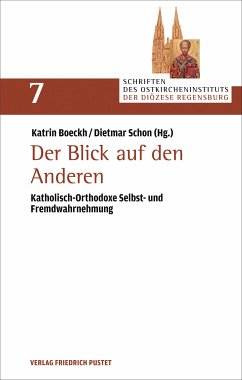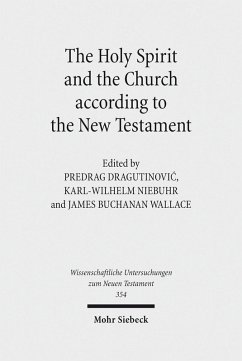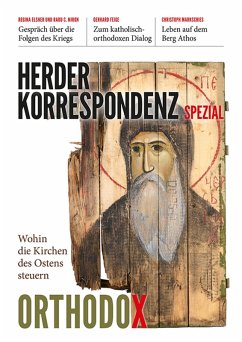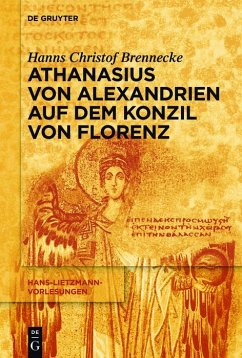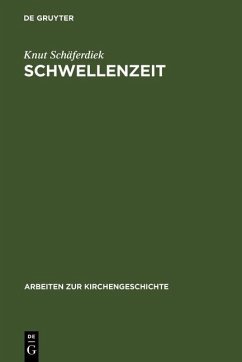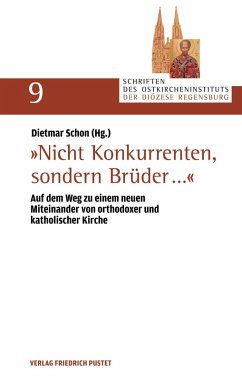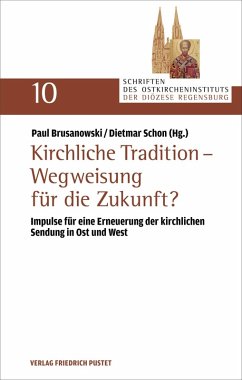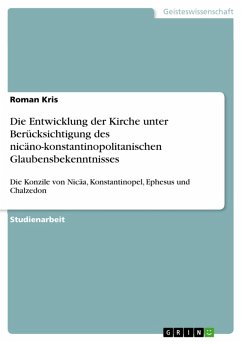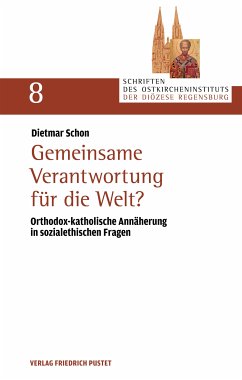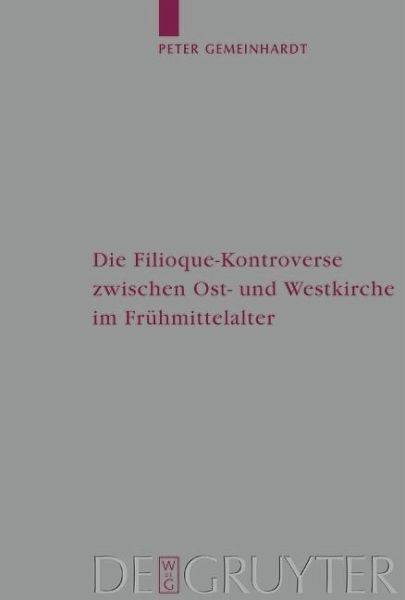
Die Filioque-Kontroverse zwischen Ost- und Westkirche im Frühmittelalter (eBook, PDF)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
189,95 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die intensiv diskutierte ökumenische und systematisch-theologische Frage, ob der Heilige Geist allein aus dem Vater oder auch aus dem Sohn hervorgeht (ex Patre Filioque), wird kirchen- und dogmengeschichtlich analysiert. Ausgehend von der differenzierten Rezeption des Nizäno-Konstantinopolitanums im lateinischen Sprachraum wird nach den Ursprüngen der Filioque-Kontroverse zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert gefragt. Dabei werden die pneumatologischen und bekenntnishermeneutischen Differenzen sowie die politischen und ekklesiologischen Rahmenbedingungen dargestellt. Der Streit um das Fil...
Die intensiv diskutierte ökumenische und systematisch-theologische Frage, ob der Heilige Geist allein aus dem Vater oder auch aus dem Sohn hervorgeht (ex Patre Filioque), wird kirchen- und dogmengeschichtlich analysiert. Ausgehend von der differenzierten Rezeption des Nizäno-Konstantinopolitanums im lateinischen Sprachraum wird nach den Ursprüngen der Filioque-Kontroverse zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert gefragt. Dabei werden die pneumatologischen und bekenntnishermeneutischen Differenzen sowie die politischen und ekklesiologischen Rahmenbedingungen dargestellt. Der Streit um das Filioque erweist sich als Schlüssel zu einer theologischen Divergenzbewegung zwischen griechischem Osten und lateinischem Westen, deren Ursprünge bereits in den trinitätstheologischen Grundentscheidungen des 4. Jahrhunderts liegen. Eine "Lösung" der Filioque-Problematik ist daher nicht durch die Streichung eines Wortes zu erreichen, sondern nur im Dialog zweier irreduzibler Ausgestaltungen des trinitarischen Dogmas.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.