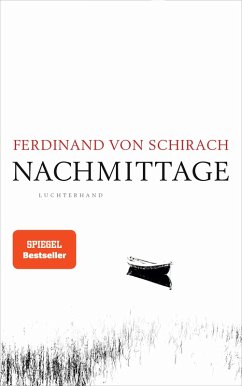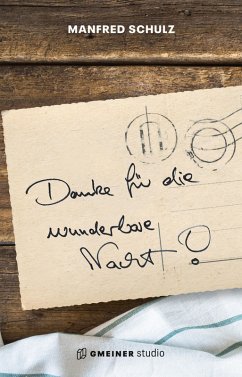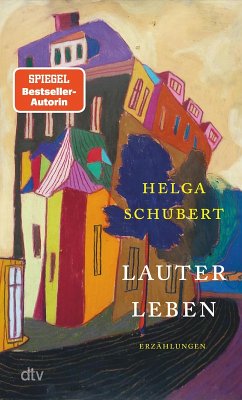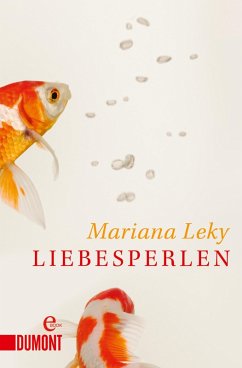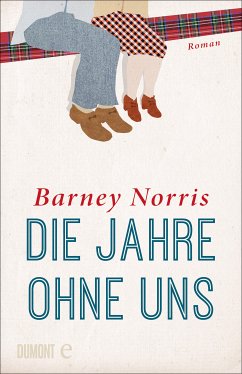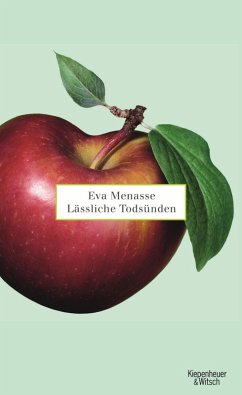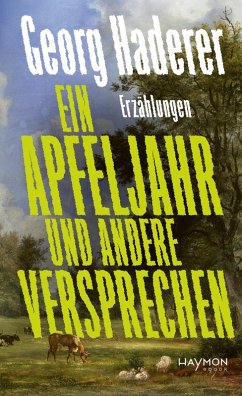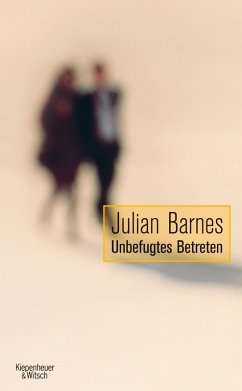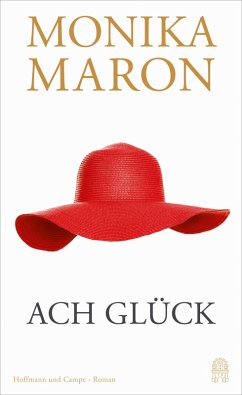Die Autorenwitwe (eBook, ePUB)
Erzählungen
Sofort per Download lieferbar
Statt: 12,00 €**
6,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Sie beginnen, 'ihr Leben zu betrachten, wie man einen langen Regentag betrachtet, die Ellenbogen auf dem Fensterbrett'. Da ist die Frau mit dem großen Hund, die statt ihres Schriftstellergatten eine Stadtschreiberstelle in der ostdeutschen Provinz antritt und ihre eigene Leere findet. Da ist der Lehrer, der nach dem Tod seiner Frau eine Schülerin trifft, die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Da ist die Frau, die für andere Leute Blumen gießt und auf erschreckende Geheimnisse stößt. 'Geschichten in der beharrlichen Ratlosigkeit', die Judith Kuckarts Erzählen ausmacht: In Sätzen, die unt...
Sie beginnen, 'ihr Leben zu betrachten, wie man einen langen Regentag betrachtet, die Ellenbogen auf dem Fensterbrett'. Da ist die Frau mit dem großen Hund, die statt ihres Schriftstellergatten eine Stadtschreiberstelle in der ostdeutschen Provinz antritt und ihre eigene Leere findet. Da ist der Lehrer, der nach dem Tod seiner Frau eine Schülerin trifft, die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Da ist die Frau, die für andere Leute Blumen gießt und auf erschreckende Geheimnisse stößt. 'Geschichten in der beharrlichen Ratlosigkeit', die Judith Kuckarts Erzählen ausmacht: In Sätzen, die unter die Haut gehen, geht sie auf Erkundungsfahrt in die menschliche Seele. Ob sie die schnellen erotischen Erlebnisse eines Verlagsvertreters mit seinen Buchhändlerinnen beschreibt oder das Schwanken einer Frau zwischen dem jugendlichen Liebhaber und dem Mann, der sie verlassen hat, Judith Kuckart formt alltägliche Begegnungen zu beklemmend nachvollziehbaren Geschichten.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, SLO, SK ausgeliefert werden.