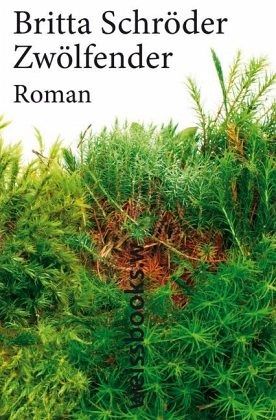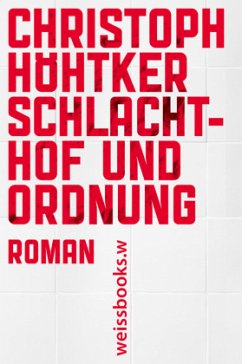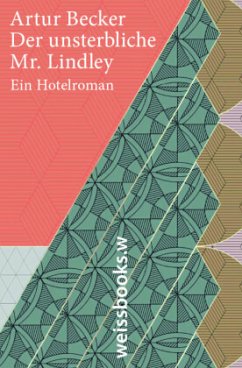Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar





Bis nach Chile und in die trockenste Wüste der Welt - eine junge Frau macht sich auf den Weg, sich von allem zu befreien. Ein außergewöhnlicher Roman voller skurriler Gestalten; eine Geschichte über das Fremdsein, das Befremden und die Freundschaft.
Schröder, BrittaBritta Schröder, geboren 1971 in Ratingen, Studium der Kunstgeschichte, Archäologie und italienischen Literatur. Veröffentlichungen über moderne und zeitgenössische Kunst. Sie lebt in Frankfurt am Main.
Produktdetails
- Verlag: weissbooks
- Artikelnr. des Verlages: 4068807
- Seitenzahl: 156
- Erscheinungstermin: 16. August 2012
- Deutsch
- Abmessung: 195mm x 132mm x 17mm
- Gewicht: 260g
- ISBN-13: 9783863370183
- ISBN-10: 386337018X
- Artikelnr.: 36025380
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Nadya Hartmann empfiehlt uns den Debütroman von Britta Schröder als souveräne Erzählung eines psychologischen Befreiungsversuches. Die Protagonistin, eine Restauratorin, erfahren wir, löst sich aus "vernarbter" Vaterliebe und aus eigenen Blockierungen, Eitelkeit, Einsamkeit. Dafür, dass der Prozess der Selbstfindung als Roman gelingt, sorgt laut Hartmann der Rückgriff auf Sartre sowie eine uneitle Sprache und die Kunst der Einfühlung, die die Autorin in Hartmanns Augen beherrscht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.12.2012
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.12.2012Eitle Krücke
Mit der Hand denken: Britta Schröders Romandebüt
Ich habe die wichtigsten Dinge im Leben greifend begriffen", sagt die Ich-Erzählerin gleich zu Beginn des Romans. Hände spielen eine wichtige Rolle in Britta Schröders Debüt. Es sind Hände, die Holzscheite wiegen, Gips anrühren und die zähe Geschmeidigkeit von Silikon prüfen. Die Protagonistin ist Restauratorin, und so viel wir über ihre Liebe zum Handwerk erfahren, so blass und namenlos bleibt sie als Person. Ihre Hände dagegen werden minutiös beschrieben. Sie sind ihr Werkzeug und der Zugang zu einer Welt, die ihrem Griff abhandenkommt. Ihre Hände fassen zu, "als gäb es keinen Zweifel". Diese Kraft ist ihr unheimlich, so wie die Welt ihr unheimlich
Mit der Hand denken: Britta Schröders Romandebüt
Ich habe die wichtigsten Dinge im Leben greifend begriffen", sagt die Ich-Erzählerin gleich zu Beginn des Romans. Hände spielen eine wichtige Rolle in Britta Schröders Debüt. Es sind Hände, die Holzscheite wiegen, Gips anrühren und die zähe Geschmeidigkeit von Silikon prüfen. Die Protagonistin ist Restauratorin, und so viel wir über ihre Liebe zum Handwerk erfahren, so blass und namenlos bleibt sie als Person. Ihre Hände dagegen werden minutiös beschrieben. Sie sind ihr Werkzeug und der Zugang zu einer Welt, die ihrem Griff abhandenkommt. Ihre Hände fassen zu, "als gäb es keinen Zweifel". Diese Kraft ist ihr unheimlich, so wie die Welt ihr unheimlich
Mehr anzeigen
ist. Es ist ein Roman über das Loslassen, der danach fragt, wie man die Welt und sich selbst darin zu fassen bekommt. Ein Blick auf die junge Gegenwartsliteratur und man mutmaßt, dass die Wahrscheinlichkeit einer gelungenen Selbstfindung der Figuren proportional zum Alter des Autors sinkt. Britta Schröder ist 1971 geboren, das lässt hoffen.
Und manchmal scheint es tatsächlich so, als neige die Erzählerin zur Tatkraft. Zugegeben, sie würde niemals auf den Tisch hauen, da ein surrender Schmerz ihr eine Narbe an der rechten Hand in Erinnerung riefe. Und doch beginnt der Roman mit einer Tat, deren Ausführung entschiedener nicht sein könnte. Nach Jahren des Schweigens sucht sie ihren Vater auf, der sich nach einem Streit von ihr abgewandt hatte. Seine Eitelkeit nagt an ihr, die Gleichgültigkeit derer, die wir bereit sind zu lieben, ist unerträglich. Natürlich geht das Treffen nicht gut aus. Aber dass es so katastrophal endet, erwartet der Leser nicht. "Ich versuchte, den Mann vor mir von meiner Geschichte zu trennen. Es glückte mir nicht, er war mir zu ähnlich." Weniger sie selbst als vielmehr ihre Hände scheinen entschlossen, und die junge Frau sticht dem Vater ein Messer in den Bauch. Ihr Kommentar: "Ich sah, dass er am Leben nicht hing." Hinter seiner Eitelkeit liegt nur Leere.
Ablehnung ist eine Wunde, die nur schwer heilt, und Verarbeitung und Verdrängung sind einander ähnlicher, als man meint. Und denken ist ohnehin nicht das, was die Protagonistin will. Im fremden Chile möchte sie "vergessen. Erst erinnern, dann vergessen." Dort angekommen, teilt sie ihre Fremdheit mit verschrobenen Sonderlingen: Merce geht auf einer Krücke und hält die Menschen mit seiner Tobsucht auf Abstand, Venia hat aufgehört zu sprechen und treibt ihre Familie in stille Verzweiflung. Wenn nichts mehr verlässlich scheint, definiert man sich durch die eigene Verlassenheit. Dass in der Demonstration der eigenen Isolation jedoch viel Eitelkeit liegt, schwant auch der Erzählerin. Sie erinnert sich an Nächte allein in Bars, an denen sie ihre Einsamkeit "herzeigte". "Verdächtig eitel", komme ihr das im Nachhinein vor, "kokett, irgendwie, und undankbar. Denn ich war nicht allein."
Im Gespräch mit Merce wirft sie schließlich die Frage auf, ob wir nicht vielleicht doch die seien, für die man uns halte. "Unser Sein erleidet einen kläglichen Abfluss ins Tun", winkt er trotzig ab, "niemand ist mit sich identisch." Man meint, Sartre bitter auflachen zu hören. Und auch der Erzählerin kommen Zweifel: "Was wir tun und sagen, wie wir sprechen, uns bewegen und Entscheidungen treffen. - All das formt doch ein Bild, das Aufschluss gibt?"
Wenn die Identitätssuche zu einem Kreisen um sich selbst gerät und die Identifikation mit Idealen an einer vernarbten Vaterliebe scheitert, muss früher oder später eine Entscheidung fallen. Ein Befreiungsakt der Protagonistin besteht zunächst darin, alles wegzuwerfen, nur noch das Nötigste zu besitzen. Die Bürde der Freiheit steht auch im Zentrum der existentialistischen Philosophie. Der Mensch ist nicht nur frei zu entscheiden, er ist auch dazu verpflichtet. Die Existenz geht der Essenz voraus, der Mensch entwirft sich selbst und trägt die Verantwortung für sein Handeln. Sartre schreibt: "Und wenn wir sagen, dass der Mensch für sich selbst verantwortlich ist, so wollen wir nicht sagen, dass der Mensch gerade eben nur für seine Individualität verantwortlich ist, sondern dass er verantwortlich ist für alle Menschen." Wie nun sieht der Selbstentwurf der Erzählerin aus?
"Man muss sich einfach verlassen", denkt sie bei einem Trip durch die Wüste. Und so verscheucht sie die Erkenntnis, dass ihre selbstgewählte Isolation nicht nur eitel, sondern auch verletzend für diejenigen ist, die sich um sie bemühen. In einem zweiten Erzählstrang entgleitet sie der Welt durch ihren Kleiderschrank. Sie wählt denselben Weg wie Merce, dessen Invalidität auch nur Show ist. Die Krücke ist sein Vorwand, keinen Schritt voranzukommen. Er umklammert sie wie die Einsamkeit, die sich "als das Einzige erwies, das Merce an sich zuverlässig wiedererkannte".
Die Autorin Britta Schröder beherrscht die Kunst der Einfühlung, und das Metier ihrer Hauptfigur ist auch ihres. Behutsam wie eine Restauratorin legt sie die Eitelkeit hinter der Einsamkeit bloß. Dass der Erzählung trotz allem etwas Handfestes innewohnt, mag an der erfrischend uneitlen Sprache liegen. Das Debüt von Britta Schröder zeichnet aus, was der Protagonistin fehlt: Souveränität.
NADYA HARTMANN
Britta Schröder: "Zwölfender".
Roman.
Weissbooks Verlag, Frankfurt am Main 2012. 156 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Und manchmal scheint es tatsächlich so, als neige die Erzählerin zur Tatkraft. Zugegeben, sie würde niemals auf den Tisch hauen, da ein surrender Schmerz ihr eine Narbe an der rechten Hand in Erinnerung riefe. Und doch beginnt der Roman mit einer Tat, deren Ausführung entschiedener nicht sein könnte. Nach Jahren des Schweigens sucht sie ihren Vater auf, der sich nach einem Streit von ihr abgewandt hatte. Seine Eitelkeit nagt an ihr, die Gleichgültigkeit derer, die wir bereit sind zu lieben, ist unerträglich. Natürlich geht das Treffen nicht gut aus. Aber dass es so katastrophal endet, erwartet der Leser nicht. "Ich versuchte, den Mann vor mir von meiner Geschichte zu trennen. Es glückte mir nicht, er war mir zu ähnlich." Weniger sie selbst als vielmehr ihre Hände scheinen entschlossen, und die junge Frau sticht dem Vater ein Messer in den Bauch. Ihr Kommentar: "Ich sah, dass er am Leben nicht hing." Hinter seiner Eitelkeit liegt nur Leere.
Ablehnung ist eine Wunde, die nur schwer heilt, und Verarbeitung und Verdrängung sind einander ähnlicher, als man meint. Und denken ist ohnehin nicht das, was die Protagonistin will. Im fremden Chile möchte sie "vergessen. Erst erinnern, dann vergessen." Dort angekommen, teilt sie ihre Fremdheit mit verschrobenen Sonderlingen: Merce geht auf einer Krücke und hält die Menschen mit seiner Tobsucht auf Abstand, Venia hat aufgehört zu sprechen und treibt ihre Familie in stille Verzweiflung. Wenn nichts mehr verlässlich scheint, definiert man sich durch die eigene Verlassenheit. Dass in der Demonstration der eigenen Isolation jedoch viel Eitelkeit liegt, schwant auch der Erzählerin. Sie erinnert sich an Nächte allein in Bars, an denen sie ihre Einsamkeit "herzeigte". "Verdächtig eitel", komme ihr das im Nachhinein vor, "kokett, irgendwie, und undankbar. Denn ich war nicht allein."
Im Gespräch mit Merce wirft sie schließlich die Frage auf, ob wir nicht vielleicht doch die seien, für die man uns halte. "Unser Sein erleidet einen kläglichen Abfluss ins Tun", winkt er trotzig ab, "niemand ist mit sich identisch." Man meint, Sartre bitter auflachen zu hören. Und auch der Erzählerin kommen Zweifel: "Was wir tun und sagen, wie wir sprechen, uns bewegen und Entscheidungen treffen. - All das formt doch ein Bild, das Aufschluss gibt?"
Wenn die Identitätssuche zu einem Kreisen um sich selbst gerät und die Identifikation mit Idealen an einer vernarbten Vaterliebe scheitert, muss früher oder später eine Entscheidung fallen. Ein Befreiungsakt der Protagonistin besteht zunächst darin, alles wegzuwerfen, nur noch das Nötigste zu besitzen. Die Bürde der Freiheit steht auch im Zentrum der existentialistischen Philosophie. Der Mensch ist nicht nur frei zu entscheiden, er ist auch dazu verpflichtet. Die Existenz geht der Essenz voraus, der Mensch entwirft sich selbst und trägt die Verantwortung für sein Handeln. Sartre schreibt: "Und wenn wir sagen, dass der Mensch für sich selbst verantwortlich ist, so wollen wir nicht sagen, dass der Mensch gerade eben nur für seine Individualität verantwortlich ist, sondern dass er verantwortlich ist für alle Menschen." Wie nun sieht der Selbstentwurf der Erzählerin aus?
"Man muss sich einfach verlassen", denkt sie bei einem Trip durch die Wüste. Und so verscheucht sie die Erkenntnis, dass ihre selbstgewählte Isolation nicht nur eitel, sondern auch verletzend für diejenigen ist, die sich um sie bemühen. In einem zweiten Erzählstrang entgleitet sie der Welt durch ihren Kleiderschrank. Sie wählt denselben Weg wie Merce, dessen Invalidität auch nur Show ist. Die Krücke ist sein Vorwand, keinen Schritt voranzukommen. Er umklammert sie wie die Einsamkeit, die sich "als das Einzige erwies, das Merce an sich zuverlässig wiedererkannte".
Die Autorin Britta Schröder beherrscht die Kunst der Einfühlung, und das Metier ihrer Hauptfigur ist auch ihres. Behutsam wie eine Restauratorin legt sie die Eitelkeit hinter der Einsamkeit bloß. Dass der Erzählung trotz allem etwas Handfestes innewohnt, mag an der erfrischend uneitlen Sprache liegen. Das Debüt von Britta Schröder zeichnet aus, was der Protagonistin fehlt: Souveränität.
NADYA HARTMANN
Britta Schröder: "Zwölfender".
Roman.
Weissbooks Verlag, Frankfurt am Main 2012. 156 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für