trockenen Humor durchzogen. Nah dran ist man, aber immer mit einer kleinen journalistischen Distanz, die nicht nur registriert, sondern das Besondere erkennt, ohne ihm gleich die Bürde einer Einordnung in die Weltläufte an und für sich zuzumuten. Dass er manches eher als Kuriosität abhakt (vorzugsweise alles Modische), lassen wir Europäer den amerikanischen Freunden ja gerne einmal durchgehen.
In "Zwischen den Gängen", das erstmals 1959 als "Between Meals" erschien, sind vor allem zwei längere Aufenthalte des Autors in Paris festgehalten, die mehr oder weniger im Zeichen des guten Essens stehen. Dafür braucht Liebling zuerst einmal einen guten Appetit, weil man ja schließlich an einem Tag "nur zwei Gelegenheiten zur Feldforschung" hat. Nach Erwähnung einiger entsprechender Heldentaten, die regelmäßig etwas mit heute kaum noch nachvollziehbaren Mengen zu tun haben, einer frühen Erwähnung des Begriffes "Textur" im Zusammenhang mit Essen und der sozusagen saftigen Beschreibung der Qualität einiger Lammkoteletts, die "von einem ermatteten Bergziegenbock" stammten und "in Maschinenöl abgesengt" worden waren, beneidet man den Autor erst einmal gründlich um die finanzielle Ausstattung durch seinen wohlhabenden Vater. Der hatte den knapp zweiundzwanzigjährigen Sohn nach frühen journalistischen Erfahrungen für ein Jahr zu Studien nach Paris geschickt, und zwar mit einer Finanzierung, die doch für ziemlich regelmäßige Feldforschung ausreichte.
Liebling nähert sich der Sache mit Akribie und erkennt Dinge, die bis heute Gültigkeit haben. Die Popularität der milden Seezunge schreibt er der Tatsache zu, dass sie eben nicht nach Fisch schmeckt, oder er tut den Geschmack junger Tiere wie Lamm und Kalb "als blasse Frühphase der jeweiligen Spezies" ab. Er beklagt die mangelnde gastronomische Bildung der Wohlhabenden und kommt zu gut entwickelten Weinbeschreibungen: "Chateauneuf macht oft den Eindruck eines Zuviel, um wahr zu sein, und seine Eigenschaften schwanken in jeder Hinsicht verheerend". Und: "Kein Asket kann als verlässlich bei Sinnen gelten", heißt es dann, während er selber die Auswirkungen seiner eigenen Verlässlichkeit mit einer auch praktizierten Vorliebe für das Boxen ausgleicht.
"The Sweet Science", eine Sammlung seiner Texte über das Boxen, wurde übrigens im Jahre 2002 von "Sports Illustrated" für die Auszeichnung zum "besten Sportbuch aller Zeiten" nominiert. Manche Beobachtungen klingen verblüffend aktuell. So beklagt Liebling schon damals "das Versagen" französischer Restaurants "in ganz elementaren Dingen", weil die Köche keine "rundum ausgebildeten Handwerker" mehr seien und immer weniger junge Leute von einiger Intelligenz das mühsame Kochhandwerk lernen wollen. Als er im Herbst 1939, knapp vor Beginn der von ihm und vielen anderen für unmöglich gehaltenen kriegerischen Auseinandersetzung mit Deutschland, wieder in Paris ist, konstatiert er einen weiteren Niedergang "der Ernsthaftigkeit des Restaurantbetriebs".
Ihn stören die Veränderung der Restaurants von "Tempeln der Dégustation zu Vitrinen für die schmalen Pagenkopfgazellen" oder die Ärzte, deren "Aufgabe es war, die Völlerei zu erleichtern, nicht, sie zu tadeln". Die Verordnungen gegen Kinderarbeit sind für ihn mit der langen Ausbildung großer Küche nicht vereinbar und die Bemühungen des frühen Guide Michelin ein Anlass zum Spott, weil ihm die Verknüpfung von Reiseführer für "Sonntagsfahrer" und "Urlaubsreisende" mit Geschmacksrichtern für Restaurants als "ein deprimierendes Beispiel" erscheint, "wie die Kunst sich dem Geschäft unterordnet".
Liebling selber ist in Sachen Essen ohne große Kenntnis der Herstellung ("ich bin's zufrieden, ein Meisterwerk der Malerei zu bewundern, ohne zu fragen, wie der Künstler seine Farben angerieben hat"), hat aber eine klare Vorstellung vom Beruf des Essers : "Die Lehrzeit des Essers ist zwar nicht so strapaziös wie die des Kochs, muß aber mit demselben Eifer und Ernst betrieben werden." Ein Gourmet wird solche Sätze sofort verstehen. Ein Nicht-Gourmet versteht so etwas grundsätzlich falsch.
Nach diesen kurzweiligen Ausführungen wird es ein wenig anrührend, weil es um ein für Liebling wohl nie so recht gelöstes Problem geht, nämlich die Frauen. "Eine Frau hat, anders als ein navarin de mouton, einen eigenen Kopf", heißt es da nach trockenen Beobachtungen wie der, dass man in den Cafés "alle Züge einer Schönheitskönigin" finden kann, "verteilt jedoch auf verschiedene Mädchen". Wahrscheinlich kam Liebling bis zu einem gewissen Grade bei Frauen an, aber wohl eher so wie die berühmten "guten Freunde", die unbedingt davon profitieren, dass sich die Frauen in ihrer Anwesenheit irgendwie ungefährdet fühlen. "Passabel" sei er, sagt ihm eine solche Freundin, und das ist ihm gleichzeitig Trost und fatalistisch angenommene Einsortierung.
Wie kann man A.J. Liebling, fragt sich der Leser, nur so unendlich uninspiriert, ohne Glanz und Esprit lediglich "passabel" finden? Liebling starb 1963 im Alter von nur neunundfünfzig Jahren nach einem Leben, in dem er sich mit gleichbleibender Akribie auch noch anderen Themen widmete. Man möchte ihm nachrufen: "Verehrter Freund, wenigstens ist dir der Ärger mit der Nouvelle Cuisine erspart geblieben."
JÜRGEN DOLLASE.
A.J. Liebling: "Zwischen den Gängen". Ein Amerikaner in den Restaurants von Paris. Aus dem Englischen übersetzt und mit einem Vorwort und Erläuterungen versehen von Joachim Kalka. Berenberg Verlag, Berlin 2007. 183 S., geb., 21,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
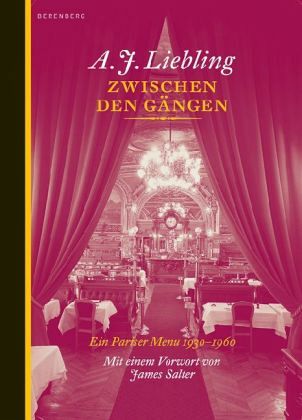




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.03.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.03.2008