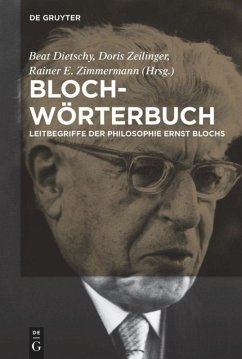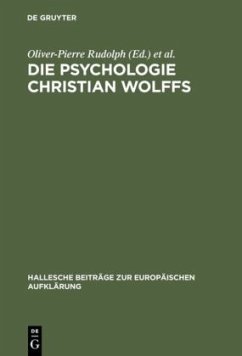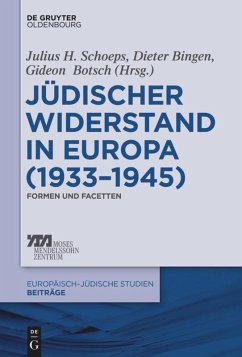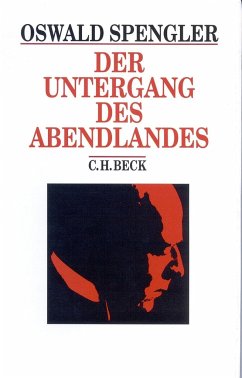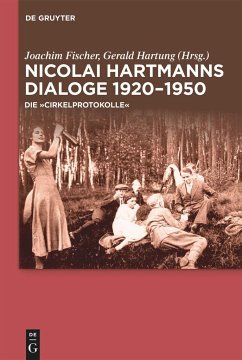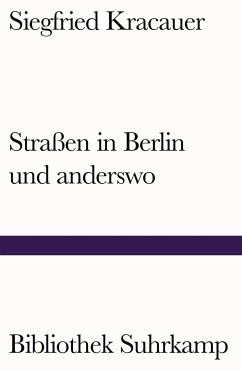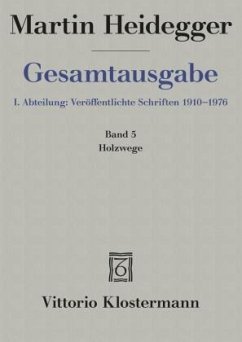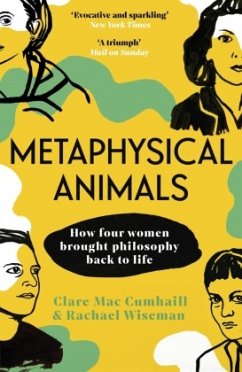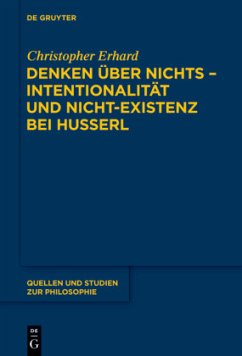skurrile Erscheinungsbild des Boheme, das philosophisch und historisch weit gestreute Werk und die intellektuelle Vermittlerpersönlichkeit im Pariser Zwischenkriegsmilieu - sie haben bisher noch nie zu einem biographischen Porträt zusammengefunden. Mit der ideengeschichtlich weit ausholenden Studie von Klaus Große Kracht liegt nun ein solches vor. Bis in die entlegendsten Archive hinein hat der Biograph seiner Figur nachgespürt und läßt hinter dem Gerücht Bernhard Groethuysen jetzt endlich auch ein Gesicht hervorschauen.
Wenig prädestinierte den 1880 in einer Berliner Arztfamilie Geborenen zum Sprung nach Paris. Über die Mitarbeit des Frischpromovierten an einer deutsch-französischen Leibniz-Ausgabe, die nähere Bekanntschaft mit dem Berliner Philosophen Wilhelm Dilthey und später mit Georg Simmel, der wiederum im Gedankenaustausch mit Henri Bergson stand, sowie durch die Freundschaft mit dem Literaturkritiker Charles Du Bos kam es auf Umwegen zum näheren Frankreichkontakt. Als Bergson in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg eine französische Werkauswahl Simmels veranlaßte, betraute er seine Studentin Alix Guillain mit der Übersetzung. Simmel ordnete ihr seinen eigenen Schüler Bernhard Groethuysen bei. Aus der gemeinsamen Arbeit der jungen Leute wurde eine dauerhafte, wenn auch nie ehelich abgesegnete Lebensbeziehung. Die Interessenverlagerung des ehemaligen Berliner Psychologiestudenten Groethuysen zur kathederfremden "Weltanschauungs"-Philosophie Diltheys, zur Neubegründung der Metaphysik zwischen Bergson und Simmel und später zur modernen Mentalitätsgeschichte wird in dieser "intellektuellen Biographie" indessen mehr ideengeschichtlich als lebensanekdotisch nachgezeichnet.
Eine nachhaltige Entfremdung von Deutschland scheint sich während des Ersten Weltkriegs vollzogen zu haben, in dem Groethuysen unter Vorzugsbedingungen als Deutscher in Châteauroux interniert war und vom Kriegsgeschehen abgeschirmt an seiner - erst postum veröffentlichten - Studie über die geistigen Voraussetzungen der Französischen Revolution arbeitete. Die zögerliche Rückkehr nach dem Krieg war von kurzer Dauer. Von 1920 an hielt der fortan in Paris Wohnhafte sich jeweils nur im Sommersemester für seine Lehrveranstaltungen als Privatdozent in Berlin auf. Im Resonanzraum von Jacques Rivières virulentem Buch "L'Allemagne" und André Gides differenzierteren "Réflexions sur l'Allemagne" gab es in Paris ein reales Bedürfnis nach Gesprächspartnern zum Wiederaufbau eines Kulturdialogs. Groethuysen schaltete sich mit seinen in der berühmten Zeitschrift NRF veröffentlichten "Lettres d'Allemagne" als einer der ersten Deutschen in die Debatte ein. Als nach dem Tod Rivières im Jahr 1925 Groethuysens Freund Jean Paulhan die Redaktionsgeschäfte in der NRF und bald auch das Cheflektorat bei Gallimard übernahm, wuchs der Einfluß des Deutschen noch mehr. Mit Paulhan zusammen gründete er 1927 die bis heute hochangesehene Reihe "Bibliothèque des Idées" bei Gallimard, deren erster Titel eine Kurzfassung seiner eigenen Studie "Die Entstehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung in Frankreich" war.
Der publizierte Teil dieser fragmentarisch gebliebenen Arbeit wurde in Deutschland wie in Frankreich mit Befremden aufgenommen. Manche Rezensenten, darunter Theodor W. Adorno, kritisierten die Diskrepanz zwischen enormer Materialfülle und schwacher theoretischer Durchdringung - eine Eigenschaft von Groethuysens Werk, die erst in neuerer Zeit auch als Qualität erkannt wurde. Mehr als in seinen großen wissenschaftlichen Studien überlebt der Autor jedoch in seinen Essays, wie die neu aufgelegten Sammlungen in Frankreich unlängst abermals zeigten. Auch als deutsch-französischer Kulturvermittler hat Bernhard Groethuysen sich nie als Wortführer in den Vordergrund gedrängt und diese Funktion gern Ambitionierteren wie etwa dem Marbacher Ernst Robert Curtius überlassen. Von 1933 an fuhr er nicht mehr zu seinen Lehrveranstaltungen nach Berlin, schloß sich aber auch nie dem Pariser Emigrantenmilieu an.
So überdauerte der "stille Kommunist", wie ihn sein Biograph nennt, ohne Parteibindung erstaunlich unbehelligt die Jahre von Besatzung und Befreiung. Als Verlagslektor bei Gallimard wich er, mittlerweile in Frankreich eingebürgert, unter deutscher Oberaufsicht von Kafka und Musil auf Klassikerausgaben von Goethe und Meister Eckhart aus. Von den Résistance-Verbindungen seiner Freunde, vorab Jean Paulhans, mag er gewußt haben, beteiligte sich aber nicht aktiv daran. Der Randgänger aus Berlin, dem André Malraux in seinem Roman "La condition humaine" die Figur des alten Gisors teilweise nachgebildet hat, wurde so selbst zu einer Verkörperung eines französischen Durchschnittsschicksals zwischen Kollaboration und Résistance. Die Pariser Nachrufe präsentierten den 1946 Verstorbenen denn auch als einheimischen Grenzgänger, dem das Auswärtige schon nicht mehr anzusehen war. In der europäischen Kollektiverinnerung gibt es nicht viele davon. Daß der Nachlaß dieses Autors bis heute verschollen blieb, kann Große Krachts Biographie beinah vergessen machen, weil sie alles Wissenswerte zum fortan maßgebenden Porträt zusammenfügt.
JOSEPH HANIMANN
Klaus Große Kracht: "Zwischen Berlin und Paris: Bernhard Groethuysen (1880 - 1946)". Eine intellektuelle Biographie. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2002. 336 S., br., 72,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
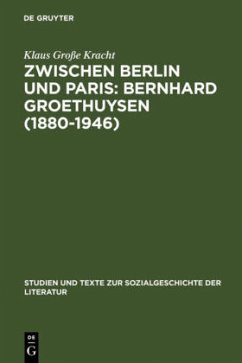






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.04.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.04.2003