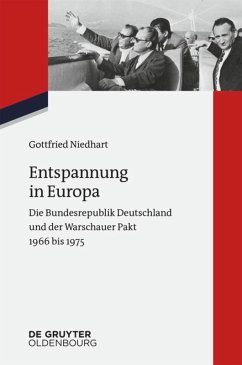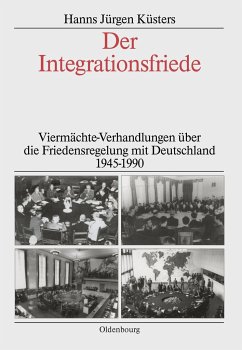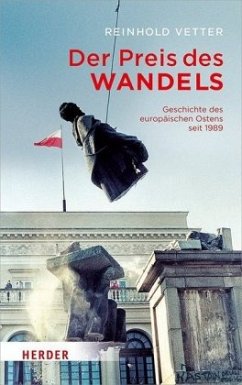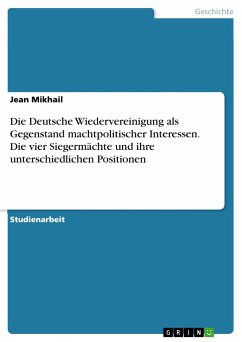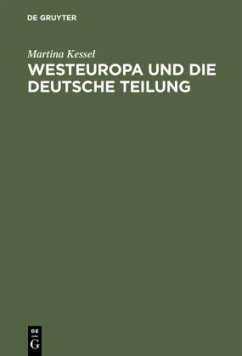ins Werk gesetzt werden.
Erst die internationale Entwicklung, die sich in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre vollzog, schuf die Rahmenbedingungen, die eine Wiedervereinigung Deutschlands zu westlichen Konditionen möglich machten. Spätestens seit dem Abschluss des Abrüstungsvertrags über die nuklearen Mittelstreckenraketen zwischen den USA und der Sowjetunion im Dezember 1987 bahnte sich ein grundlegender Wandel des internationalen Systems an, der nicht nur Europa erfasste, sondern sich auch in Entwicklungen in den anderen, bis dahin in gleicher Weise von der Blockkonfrontation geprägten Teilen der Welt niederschlug. Dafür waren ein Umdenken der politischen Führungen - in Moskau wie in Washington - sowie erste vertrauensbildende Maßnahmen ursächlich (Hélène Miard-Delacroix).
Der von Generalsekretär Michail Gorbatschow unter den Schlagworten Glasnost und Perestroika eingeleitete Reformprozess führte indes nicht nur zu einem neuen Denken in der sowjetischen Außenpolitik, sondern erfasste auch die inneren Verhältnisse in der Sowjetunion und innerhalb des Ostblocks. Er entfaltete hier schließlich eine von ihrem Urheber nicht mehr beherrschbare Dynamik, die zur Auflösung des Ostblocks, des Warschauer Pakts (Helmut Altrichter) und schließlich auch der Sowjetunion selbst führte.
Im Rahmen dieser Entwicklung entstand - für eine kurze Zeit - eine internationale Konstellation, in der mittels des Zwei-plus-vier-Prozesses die Vereinigung der beiden deutschen Staaten realisiert werden konnte. Die größte Unterstützung bei ihrer Wiedervereinigungspolitik erfuhr die Bundesrepublik dabei bekanntermaßen durch die USA. Doch gab es durchaus Spannungen zwischen den USA und der Bundesrepublik bei der Herstellung der Einheit, die vor allem die Frage der Osterweiterung der NATO betrafen (Mary Elise Sarotte). Differenzen bestanden insoweit zeitweise nicht nur zwischen den Regierungen, sondern auch innerhalb der amerikanischen Regierung (Präsident Bush/Außenminister Baker) und der Bundesregierung (Bundeskanzler Kohl/Außenminister Genscher). Die Jahre später erfolgte Osterweiterung der NATO hat im Übrigen wesentlich dazu beigetragen, dass in Russland die Wiedervereinigung teilweise als schwerwiegende politische und militärische Niederlage angesehen wird (Wolfgang Mueller).
Ein zentrales Thema der Vorgespräche zum Zwei-plus-vier-Vertrag war die Frage, ob dieser als Friedensvertrag im klassischen Sinne ausgestaltet werden sollte. Wegen drohender Reparationsforderungen in gigantischer Höhe wollte die Bundesregierung unter allen Umständen einen förmlichen Friedensvertrag vermeiden, der leicht zu einem "Super-Versailles" hätte werden können. Tatsächlich gelang es schließlich, mit dem Zwei-plus-vier-Vertrag eine abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland zu treffen, die kein Wort über Reparationen verlor.
Hat Deutschland auf diese Weise auch die Entstehung von Reparationslasten gegenüber anderen Staaten verhindern können, so entging es doch "nicht dem moralischen Druck und seiner Verantwortung für die Opfer des NS-Regimes" (Jürgen Lillteicher). Nach der Wiedervereinigung wurde es vor allem aus Osteuropa mit Entschädigungsforderungen für Zwangsarbeiter konfrontiert und sah sich zum Schutz deutscher Großunternehmen, auch vor Schadensersatzklagen in den USA, zu Globalabkommen und Ex-gratia-Zahlungen genötigt.
Wie hat sich die internationale Ordnung nach der Wiedervereinigung entwickelt? Die KSZE hat nach dem Wegfall des Ost-West-Gegensatzes, bei dem sie eine Brückenfunktion besaß, ungeachtet ihrer Internationalisierung keine zentrale Rolle einnehmen können; sie geriet vielmehr ins Abseits (Hermann Wentker). Sicherheit versprach die NATO, Wohlstand die EU. Die mittelosteuropäischen Staaten betrachteten die Anbindung an die EU - "unter Ausblendung der offensichtlichen supranationalen Elemente im europäischen Integrationsprozess" - nicht als Verzicht auf nationale Souveränität (Wanda Jarzabek). Das Missverständnis wirkt bis heute nach und bildet die tiefere Ursache für die Konflikte zwischen Polen, Ungarn und der EU.
Fehlvorstellungen, die zu Enttäuschungen, Verstimmungen und Animositäten führen, prägen bis heute auch das Bild, das sich Partnerländer vom wiedervereinigten Deutschland machen. Während die USA politische und militärische Führungsschwäche diagnostizieren (Konrad H. Jarausch), treibt andere (Po-len, aber auch England oder Frankreich) mitunter die wirkliche oder vermeintlich Sorge vor einem "Vierten Reich" um: Allzu große Europaseligkeit wird als besonders perfide Form deutschen Nationalismus wahrgenommen (Dominik Geppert). So bleibt die internationale Ordnung volatil, Deutschlands Rolle in ihr noch immer unbestimmt. CHRISTIAN HILLGRUBER
Tim Geiger, Jürgen Lillteicher, Hermann Wentker (Hrsg.): Zwei plus Vier. Die internationale Gründungsgeschichte der Berliner Republik.
De Gruyter Oldenbourg Verlag, Berlin 2021. 251 S., 24,95 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
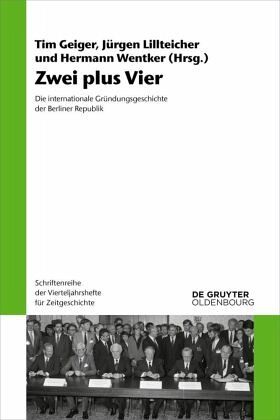




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.04.2022
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.04.2022