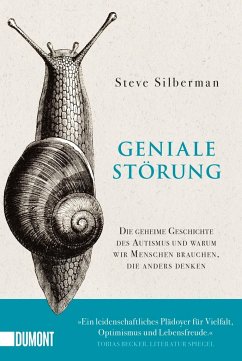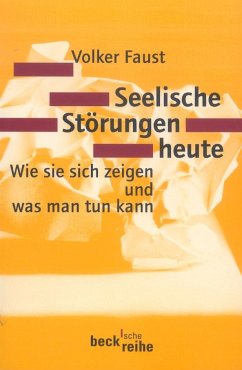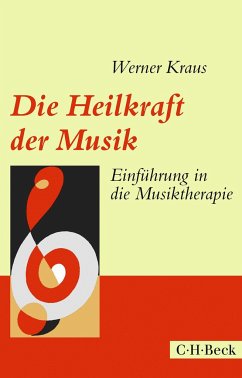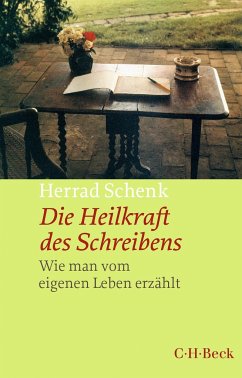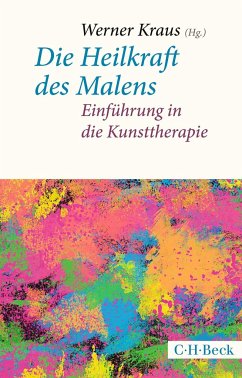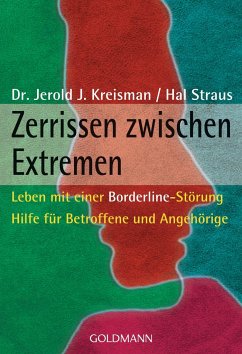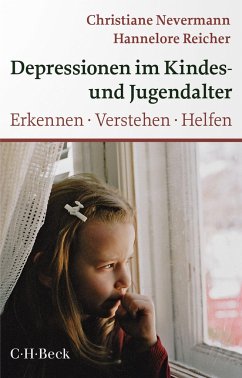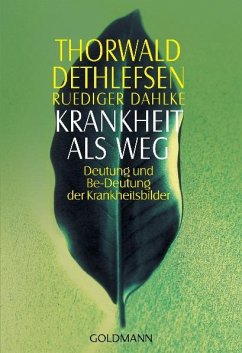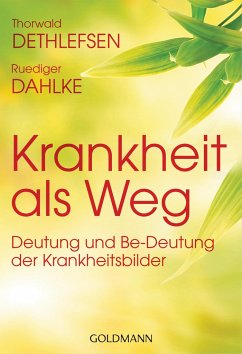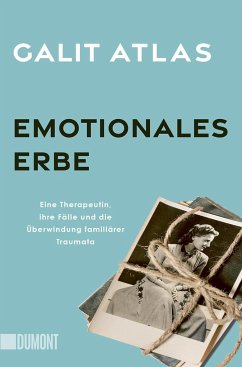Otto Benkert, Direktor der psychiatrischen Universitätsklinik Mainz, und die Medizinjournalistin Martina Lenzen-Schulte weitere Störungen aus dem Formenkreis der Zwangserkrankungen dar. Dabei wird deutlich, wie fließend die Übergänge von den Alltagshandlungen Gesunder zu den Ritualen Zwangskranker sind. Denn die meisten Menschen kontrollieren, ob Wohnung oder Auto verriegelt sind, auch wenn sie gerade abgeschlossen haben. Zwangskranke fühlen sich jedoch gedrängt, derartige Handlungen hundertmal oder öfter zu vollziehen. Sinnvolles Arbeiten und ausgeglichenes Privatleben werden durch den Zwang zumeist unmöglich.
Auch der Zwang, Zeitungen über Jahrzehnte zu sammeln, wird manchem Leser bekannt sein. Wenige bringen es zu der krankhaften "Perfektion", durch ihren Sammelzwang dazu gedrängt zu werden, eine zusätzliche Wohnung zu mieten. Die Zwangserkrankung eines Chirurgen, von dem berichtet wird, erfordert hingegen einschlägige Vorbildung: Aus Angst vor einer Leistenhernie untersuchte der Arzt mehrere hundert Male am Tag seine Leistenregion, so daß sich ein Geschwür bildete.
Zwangskrankheiten im Kindesalter werden ebenso vorgestellt wie Impulskontrollstörungen (Spielsucht, Kaufsucht, Kleptomanie und die Trichotillomanie - der Zwang, sich Haare ausreißen zu müssen), Eßstörungen und die Hypochondrie. Neurobiologische, lerntheoretische, ethologische und psychoanalytische Modelle geben Einblick in das gegenwärtige Verständnis von Zwangskrankheiten. Gezeigt wird auch, daß die beiden erfolgversprechendsten Therapieansätze, die Verhaltenstherapie und die medikamentöse Behandlung, noch keine Ideallösungen darstellen.
Die Autoren bedauern, daß ihr Thema unter den psychiatrischen Erkrankungen wenig Beachtung findet. Anders als die Schizophrenie etwa, die aus der engen Verbindung, in der Genie und Wahnsinn traditionell gedacht wurden, eine beständige Faszination bezog, oder die Depression, deren Nimbus des melancholischen Zweifels gesellschaftliches Interesse hervorrief. Der umgangssprachlich negativ bewertete Begriff "zwanghaft" und die fehlende Abgrenzung von Zwangskrankheit und zwanghafter Persönlichkeit haben zusätzlich zu dem fehlenden Verständnis für das Leiden Zwangskranker beigetragen. Dabei ist ein Zwangskranker gerade nicht ein übermäßig penibler Mensch, sondern jemand, dem die Ordnung seines Alltags wegen der alles dominierenden Zwänge nicht mehr gelingt.
Auch der amerikanische Milliardär Howard Hughes, vielleicht der berühmteste Zwangskranke, taugte wenig zum Sympathieträger, denn er tyrannisierte seine Mitmenschen mit sinnlosen Detailanweisungen, um das Einschleppen von Keimen in seine Umgebung zu verhindern. Die unendlichen Rituale zur Keimvermeidung machten es Hughes unmöglich, eine normale Hygiene durchzuführen, so daß sich seine Fingernägel aufrollten. Unzählige Leidensgeschichten bleiben unbekannt - die Zwangskrankheit gilt als "heimliche Krankheit", denn Patienten offenbaren ihr Leiden nur selten. In Deutschland vermuten neuere Untersuchungen etwa eine Million Zwangskranke. WERNER BARTENS
Otto Benkert, Martina Lenzen-Schulte: "Zwangskrankheiten". Ursachen, Symptome, Therapien. Beck'sche Reihe Wissen. C. H. Beck Verlag, München 1997. 125 S., br., 14,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
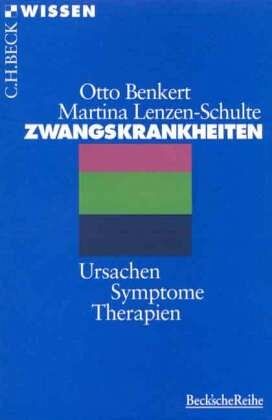




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.08.1997
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.08.1997