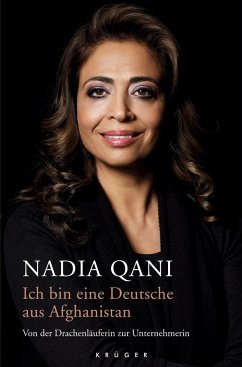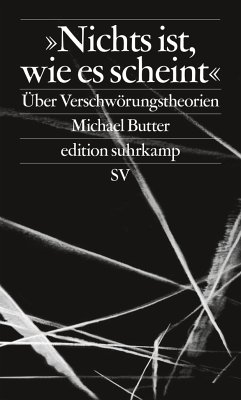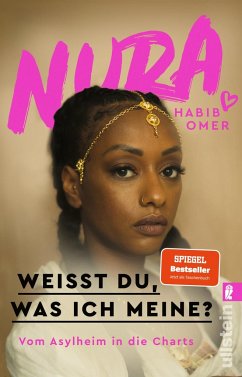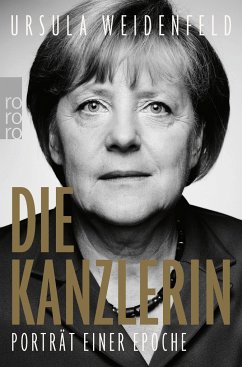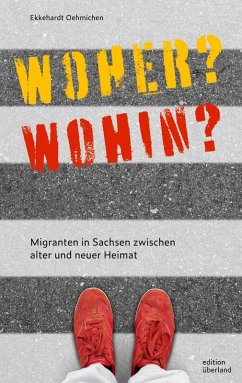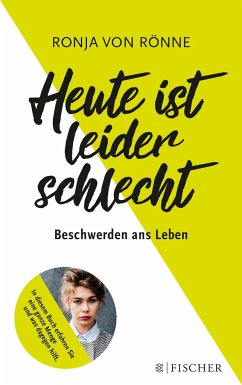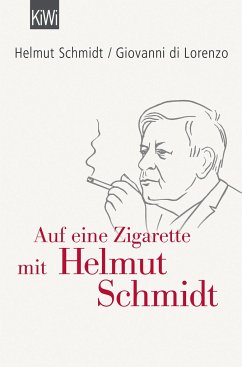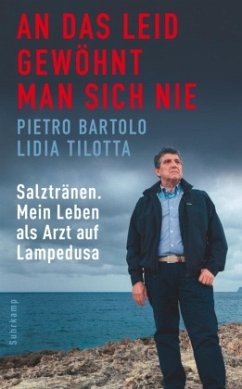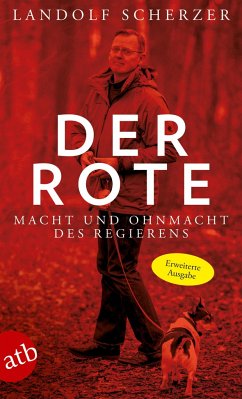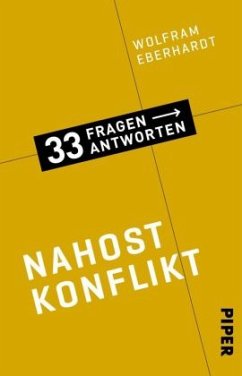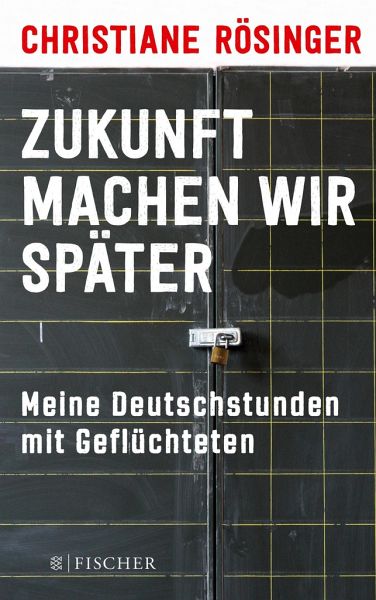
Zukunft machen wir später
Meine Deutschstunden mit Geflüchteten
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
16,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Seit September 2015 gibt die Berliner Musikerin und Autorin Christiane Rösinger Deutschunterricht für Geflüchtete. Ihr Kreuzberger Anfänger-Kurs ist Teil einer freien Deutschkurs-Initiative für Menschen, die oft keine anderen Angebote zum Spracherwerb bekommen und die, wie es im Behördenjargon heißt, »keine gute Bleibeperspektive« haben. Aber nicht nur die Kursteilnehmer kämpfen mit trennbaren Verben und »den verdammten drei 'sie'« der deutschen Sprache, auch Christiane Rösinger hat alle Mühe, das »Lernziel« zu erreichen und sich selbst zu integrieren. Bis das gelingt, schlägt...
Seit September 2015 gibt die Berliner Musikerin und Autorin Christiane Rösinger Deutschunterricht für Geflüchtete. Ihr Kreuzberger Anfänger-Kurs ist Teil einer freien Deutschkurs-Initiative für Menschen, die oft keine anderen Angebote zum Spracherwerb bekommen und die, wie es im Behördenjargon heißt, »keine gute Bleibeperspektive« haben. Aber nicht nur die Kursteilnehmer kämpfen mit trennbaren Verben und »den verdammten drei 'sie'« der deutschen Sprache, auch Christiane Rösinger hat alle Mühe, das »Lernziel« zu erreichen und sich selbst zu integrieren. Bis das gelingt, schlägt sie sich mit den beiden größten Hindernissen für eine gelingende Integration herum - der deutschen Gesellschaft und der deutschen Grammatik.