Weltgeschichte des Zorns geschrieben hat, ist diese Austreibung des produktiven Zorns aus der Kultur lähmend. Anstatt aufwallende Energien kollektiv und domestiziert zu nutzen - er versteht Zorn im Sinne des antiken "thymos" als in der Polis zivilisierte Form des Furors homerischer Helden -, zerstreuen wir unsere Kräfte wirkungslos. Die Empörung hat keine Weltidee vorzuweisen. Also habe mit großer Folgerichtigkeit "die Mitte, das formloseste der Monstren", das Gesetz der Stunde erkannt: Gefragt seien belastbare Langweiler, von denen erwartet wird, an großen runden Tischen die Weltformeln des Ausgleichs zu finden.
"Zorn und Zeit" ruft nach der Rehabilitierung dessen, was Sloterdijk die "thymotischen Energien" nennt. Das ist kein leichtes und kein selbstverständliches Projekt, hat der Zorn als politische Energie im zwanzigsten Jahrhundert doch Verheerendes angerichtet. Blickt man auf das vergangene Jahrhundert zurück, schreibt Sloterdijk, so drängt sich der Eindruck auf, daß in ihm die von Platon geforderte, von Aristoteles gelobte und von den Pädagogen des bürgerlichen Zeitalters praktisch versuchte Zivilisierung der Zorn-Energien in den Nationalstaaten gescheitert sei. Die starken Regungen der Menge für einen "Fortschritt" zu nutzen schlug katastrophal fehl - egal ob die Manager der Zornpolitik rote oder braune Kittel trugen.
Verheerend mußte diese Zornwirtschaft sein, weil sie eine Kriegswirtschaft des Ressentiments war. In großen, vom Furor seiner Metaphernwirtschaft zuweilen hinweggetragenen Kapiteln (Sloterdijk gefällt seine Allegorie von den verwaltenden "Weltbanken des Zorns" so sehr, daß er das Vokabular, von der "Veruntreuung der Zornkapitale" über "Thymosmonopole" bis hin zu "thymotischen Renditen", ausreizt) führt er diese These historisch aus. Zorngeschäfte wurden unter verhängnisvollen Vorzeichen durch die Jahrhunderte gemacht, wobei die Revolutionäre des neunzehnten Jahrhunderts das Versprechen endgültiger Gerechtigkeit, das die Kirche auf das Jenseits verschob, in die irdische "Geschichte" verlegten. Lenin, Stalin und Mao sind für Sloterdijk "Weltgeistliche des Hasses" mit "makelloser Rücksichtslosigkeit".
Die Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts gehen für ihn auf das Konto der modernen Radikalismen, "die dem kollektiven Zorn, unter idealistischen wie materialistischen Vorwänden, nie betretene Wege zur Befriedigung weisen wollten - Wege, die vorbei an moderierenden Instanzen wie den Parlamenten, den Gerichten, den öffentlichen Debatten, auf gewaltige Freisetzungen von ungefilterten Racheenergien, Ressentiments und Ausrottungswünschen zuliefen". Betrachtet man die gegenwärtig freiwerdenden Rachenergien des Islamismus, wird deutlich, wie sehr das Ressentiment eine treibende Kraft ist. Uns steht noch einiges bevor.
Es hieße Peter Sloterdijk aber mißverstehen, wenn man glaubte, es ginge ihm in "Zorn und Zeit" nur deshalb um die Analyse der Zornwirtschaft des zwanzigsten Jahrhunderts, um düstere Szenarien für die Zukunft zu entwerfen. Die nahe Zukunft sieht tatsächlich düster aus. Es steht für ihn außer Frage, daß in Tausenden von Koranschulen, die überall dort aus dem Boden schießen, wo es Jungmännerüberschüsse gibt, weiterhin Märtyrer auf Heiligen Krieg getrimmt werden. Ein kleiner Teil werde zu terroristischen Zwecken eingesetzt, der größere in Bürgerkriege auf arabischen Territorium investiert werden - Kriege, von denen das iranisch-irakische Massaker von 1980 bis 1988 einen Vorgeschmack gegeben hat. Es steht für ihn auch außer Frage, daß Israel weitere Bewährungsproben vor sich hat, also ohne eine weitsichtige Politik der Abschottung gar nicht wird überstehen können. "Selbst Kenner der Lage", so lautet die Diagnose, "besitzen heute nicht die geringste Vorstellung davon, wie der machtvoll anrollende muslimische youth bulge, die umfangreichste Welle an genozidschwangeren Jungmännerüberschüssen in der Geschichte der Menschheit, mit friedlichen Mitteln einzudämmen wäre."
Doch liegt es nicht im Interesse Sloterdijks, bloß die Rolle des düsteren Propheten zu spielen. Was ihn umtreibt, ist die Frage, woraus der politische Islam seine Drohgewalt bezieht und ob er das Potential hat, sich zu einer "Weltbank des Zorns" zu entfalten, also den Kommunismus als Weltdogma abzulösen. Die Antwort fällt negativ aus: Für Sloterdijk stellt der radikale Islamismus eine allein auf Rache gegründete Ideologie dar, die strafen kann, die aber nichts hervorbringt. Die Anschläge vom 11. September 2001 machen dies deutlich: Sie seien keine Demonstration islamistischer Stärke gewesen, sondern das Symbol einer hämischen Mittellosigkeit, zu deren Kompensation nichts als die religiös maskierte Opferung von Menschenleben aufzubieten war. Sicher wird der Traum der Aktivisten von einem islamischen Großimperium viele gewaltbereite Mitträumer inspirieren. Die politischen Voraussetzungen für ein solches Imperium aber fehlen. Aus regionalen Reichsbildungen islamischer Staaten könnten sich bestenfalls konventionelle Mittelmächte entwickeln. Grundsätzlich, schreibt Sloterdijk, hat der Islam wenig vorzuweisen, was ihn befähigte, die technologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Existenzbedingungen für die Menschheit des einundzwanzigsten Jahrhunderts fortzubilden.
Die Einschüchterung funktioniert, und sie kommt den angegriffenen westlichen Mächten auf eine bitter-ironische Weise gelegen: Trotz wachsender sozialer Ungleichheiten können wieder nationale Solidargemeinschaften beschworen werden, "Überlebenseinheiten", in denen der Imperativ der Sicherheit regiert. Sich aus den mittlerweile wohlbekannten nahöstlichen Quellen bedroht fühlen bedeutet jetzt: Gründe sehen, warum man eventuell bereit sein könnte, sich in der westlichen politischen Kultur von demokratischen Zuständen zu verabschieden. Doppelt bitter daran ist, "Zorn und Zeit" zufolge, daß der Islamismus über den Rang eines Randphänomens, das er vor kurzem noch war, tatsächlich nie so rasend schnell gekommen wäre, wenn die westlichen Gesellschaften ihn nicht so bereitwillig für ihre innerpolitischen Zwecke genutzt hätten und weiterhin nutzen.
Gibt es eine Chance für einen ressentimentfreien Zorn heute? Für einen Zorn, der anderes hervorbringt als Vergeltungsdrang? Als treibende politische Kraft, das muß Sloterdijk einräumen, hat der Zorn nicht gerade seine besten Zeiten hinter sich. Eher im Gegenteil. Doch gibt es Nietzsche, und in gewisser Weise muß man sich Sloterdijk als demokratisch denkenden Nietzsche-Leser vorstellen. Was er in seinen mit "Jenseits des Ressentiments" überschriebenen Schlußfolgerungen in Aussicht stellt, ist eine mit Nietzsche gedachte Ablösung der "rachsüchtigen Demut" durch eine Intelligenz, die sich ihres produktiven Zorns neu vergewissert. Sloterdijk zufolge konnte das Verlangen nach Gerechtigkeit für die Welt - sei es jenseits des irdischen Lebens, sei es in der geschehenden Geschichte - zur Theologie des Gotteszornes und zum Kommunismus nur so lange Zuflucht nehmen, wie die Verbindung von Geist und Ressentiment stabil war. Das religiös und politisch überhöhte Vergeltungsdenken ist seiner Ansicht nach an sein Ende gekommen. Es sei Zeit für die Befreiung der Weltkultur vom Geist des Ressentiments.
Sloterdijks gewaltig erzählte Analyse der Zornkollektive liefert die historischen Voraussetzungen für das, was er als eine ressentimentfreie politische Theorie des Zorns erst noch zu entwerfen verspricht. Sie ist ein erster Schritt. Daß man sich auf eine solche Theorie in einer Welt, in der ganze Kulturen sich beleidigt fühlen und damit beschäftigt sind, diese Beleidigtheit in negative Energie umzuwandeln, nur freuen kann, ist klar. Sie wäre eine echte Option.
Peter Sloterdijk: "Zorn und Zeit". Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2006. 356 S., geb., 22,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
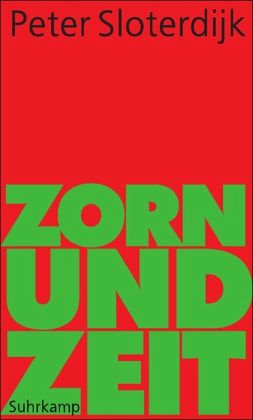






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.10.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.10.2006