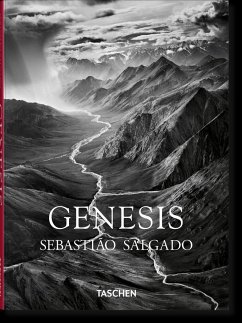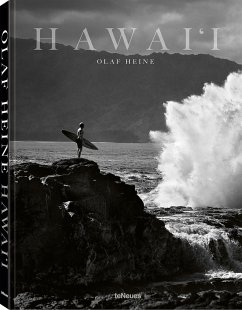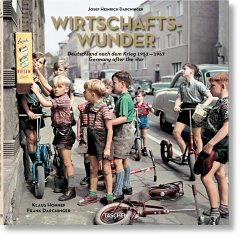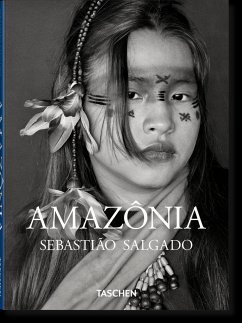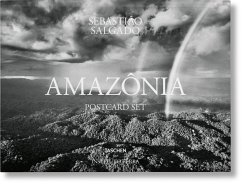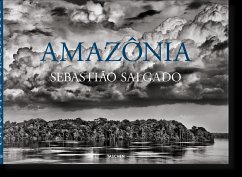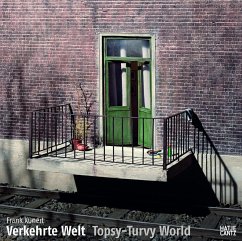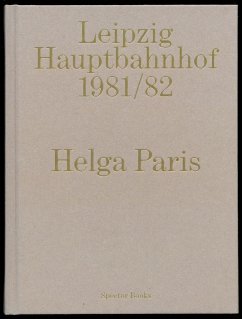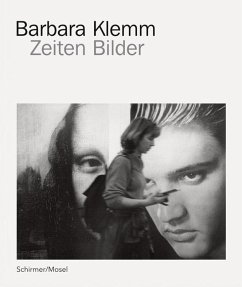Roman Paul Widera
Broschiertes Buch
Zerfallspoetik
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!



Produktdetails
- Verlag: Brinkmann U. Bose / Brinkmann, Erich, u. Günter Bose
- Seitenzahl: 88
- Erscheinungstermin: Januar 2023
- Deutsch
- Abmessung: 233mm x 151mm x 10mm
- Gewicht: 186g
- ISBN-13: 9783940048448
- ISBN-10: 3940048445
- Artikelnr.: 69838355
Herstellerkennzeichnung
Brinkmann U. Bose
Leuschner Damm 13
10999 Berlin
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.01.2024
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.01.2024Sichten und sichern
Roman Paul Widera denkt über den Zerfall von Filmstreifen nach
Die letzte Szene des Films "Two-Lane Blacktop" (1971) von Monte Hellman ist aus einem bestimmten Grund berühmt. Man sieht da, wie ein Mann in einem 1955er-Chevrolet auf einer geraden Landstraße Gas gibt. Die Kamera ist auf den offenen Horizont nach vorn gerichtet, der Motor heult auf, Geschwindigkeit und Energie übertragen sich auf das Filmbild, es fängt Feuer - und verbrennt. Es soll so aussehen, als wäre tatsächlich das Zelluloid von den Flammen betroffen in dem jeweiligen Kino, in dem der Film gerade läuft.
Das Experimentalkino trifft hier auf das populäre amerikanische Kino, eine Avantgardegeste entsteht aus einem Stück
Roman Paul Widera denkt über den Zerfall von Filmstreifen nach
Die letzte Szene des Films "Two-Lane Blacktop" (1971) von Monte Hellman ist aus einem bestimmten Grund berühmt. Man sieht da, wie ein Mann in einem 1955er-Chevrolet auf einer geraden Landstraße Gas gibt. Die Kamera ist auf den offenen Horizont nach vorn gerichtet, der Motor heult auf, Geschwindigkeit und Energie übertragen sich auf das Filmbild, es fängt Feuer - und verbrennt. Es soll so aussehen, als wäre tatsächlich das Zelluloid von den Flammen betroffen in dem jeweiligen Kino, in dem der Film gerade läuft.
Das Experimentalkino trifft hier auf das populäre amerikanische Kino, eine Avantgardegeste entsteht aus einem Stück
Mehr anzeigen
Warenfetischismus, denn nichts anderes ist der getunte Wagen, ein Fetisch des Traums von Raserei und einer Bewegung ins Nichts. Das Kino trifft in diesem Moment auch auf sein Material: auf den Filmstreifen, auf dem bis zur Digitalisierung die Bilder festgehalten wurden. Ein verletzliches Material, das nach einer gewissen Zeit Spuren seines Gebrauchs zeigt. Quentin Tarantino hat einmal einen seiner Filme bewusst in das Zeichen dieser Strapazen gestellt: "Death Proof" (2007) sollte so aussehen wie eine zerkratzte, von Vorführern mit der Schere misshandelte und nach Filmriss notdürftig geflickte Kopie.
Das Filmbild ist nicht stabil, es unterliegt dem Zahn der Zeit. Roman Paul Widera, bisher vor allem mit Lyrik hervorgetreten, hat diesem Umstand nun ein kleines Buch gewidmet: "Zerfallspoetik" setzt sich essayistisch damit auseinander, dass Film in den ersten gut hundert Jahren des Kinos ein fragiles Trägermaterial hatte. Alte Kopien aus den ersten Jahrzehnten sind heute geradezu explosiv, die Archive haben gut damit zu tun, Bestände nicht nur zu sichten, sondern auch zu sichern.
Widera beginnt mit Beispielen einer künstlerischen Aneignung dieser Zerfallsprozesse. "Light is Calling" (2004) von Bill Morrison nimmt den Stummfilm "The Bells" aus dem Jahr 1926 als Ausgangspunkt, interessiert sich allerdings kaum mehr für dessen Erzählung, sondern vor allem dafür, was nach dem weitgehenden Zerfall des Trägermediums von dem alten Film überhaupt noch übrig ist. Fetzen einer Geschichte unter dem Moder des Materials. Ähnlich funktioniert "Lyrisch Nitraat" von Peter Delpeut, der lange Zeit für das Amsterdamer Filmmuseum gearbeitet hat und dort Zugang zu vielen Schätzen des frühen Kinos hatte.
Widera zieht für seine Poetik zahlreiche Motive aus der Theoriebildung im zwanzigsten Jahrhundert heran. Mit Roland Barthes und André Bazin denkt er darüber nach, welche Beziehung das analoge fotografische Bild zur Zeit und damit letztlich zum Tod hat. Ein Foto schlägt dem Tod ein Schnippchen, heißt es manchmal, denn es hält zumindest einen lebendigen Augenblick für immer fest, wobei Widera dann eben stärker auf den anderen Aspekt abhebt, dass nämlich auch dieses Festhalten wieder an Zeitlichkeiten gebunden ist, solche vergilbenden Papiers zum Beispiel.
Mit Walter Benjamin, der aus naheliegenden Gründen mehrfach als Kronzeuge für die Überlegungen in "Zerfallspoetik" fungiert, gelangt Widera zu einer Deutung des Filmbilds nicht so sehr als Errettung der äußeren Wirklichkeit (vor dem unwiderruflichen Verfall in die Vergangenheit), sondern als deren Fortexistenz als Ruine. An diesem Punkt wird deutlich, dass der Essay sich durchaus poetische Freiheiten mit klassischen Themen der Theorie nehmen kann.
Spannend wäre es gewesen, ausführlicher darüber nachzudenken, wo denn entsprechende Prozesse in der anscheinenden Ewigkeit des digitalen Bildes zu finden wären. Überall arbeiten die Kinematheken derzeit ja daran, das "Filmerbe" in Datenbanken zu übertragen. In der Cloud, wo die Filme dann virtuell lagern, altert nichts. Damit ist das Kino von seinen bisherigen Lebenszyklen abgeschnitten. Es hat nun keine Substanz mehr, steht aber unter Strom: Die Bilder existieren nur, weil sie die ganze Zeit mit Elektrizität massiert (oder gefoltert) werden. Das sind Metaphern zu einer Ontologie, die vielleicht einer eigenen Ruinenkunde bedarf. Nach "Zerfallspoetik" würde man eine solche von Roman Paul Widera gern lesen. BERT REBHANDL
Roman Paul Widera: "Zerfallspoetik".
Brinkmann & Bose, Berlin 2023. 88 S., Abb., br.,
24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Das Filmbild ist nicht stabil, es unterliegt dem Zahn der Zeit. Roman Paul Widera, bisher vor allem mit Lyrik hervorgetreten, hat diesem Umstand nun ein kleines Buch gewidmet: "Zerfallspoetik" setzt sich essayistisch damit auseinander, dass Film in den ersten gut hundert Jahren des Kinos ein fragiles Trägermaterial hatte. Alte Kopien aus den ersten Jahrzehnten sind heute geradezu explosiv, die Archive haben gut damit zu tun, Bestände nicht nur zu sichten, sondern auch zu sichern.
Widera beginnt mit Beispielen einer künstlerischen Aneignung dieser Zerfallsprozesse. "Light is Calling" (2004) von Bill Morrison nimmt den Stummfilm "The Bells" aus dem Jahr 1926 als Ausgangspunkt, interessiert sich allerdings kaum mehr für dessen Erzählung, sondern vor allem dafür, was nach dem weitgehenden Zerfall des Trägermediums von dem alten Film überhaupt noch übrig ist. Fetzen einer Geschichte unter dem Moder des Materials. Ähnlich funktioniert "Lyrisch Nitraat" von Peter Delpeut, der lange Zeit für das Amsterdamer Filmmuseum gearbeitet hat und dort Zugang zu vielen Schätzen des frühen Kinos hatte.
Widera zieht für seine Poetik zahlreiche Motive aus der Theoriebildung im zwanzigsten Jahrhundert heran. Mit Roland Barthes und André Bazin denkt er darüber nach, welche Beziehung das analoge fotografische Bild zur Zeit und damit letztlich zum Tod hat. Ein Foto schlägt dem Tod ein Schnippchen, heißt es manchmal, denn es hält zumindest einen lebendigen Augenblick für immer fest, wobei Widera dann eben stärker auf den anderen Aspekt abhebt, dass nämlich auch dieses Festhalten wieder an Zeitlichkeiten gebunden ist, solche vergilbenden Papiers zum Beispiel.
Mit Walter Benjamin, der aus naheliegenden Gründen mehrfach als Kronzeuge für die Überlegungen in "Zerfallspoetik" fungiert, gelangt Widera zu einer Deutung des Filmbilds nicht so sehr als Errettung der äußeren Wirklichkeit (vor dem unwiderruflichen Verfall in die Vergangenheit), sondern als deren Fortexistenz als Ruine. An diesem Punkt wird deutlich, dass der Essay sich durchaus poetische Freiheiten mit klassischen Themen der Theorie nehmen kann.
Spannend wäre es gewesen, ausführlicher darüber nachzudenken, wo denn entsprechende Prozesse in der anscheinenden Ewigkeit des digitalen Bildes zu finden wären. Überall arbeiten die Kinematheken derzeit ja daran, das "Filmerbe" in Datenbanken zu übertragen. In der Cloud, wo die Filme dann virtuell lagern, altert nichts. Damit ist das Kino von seinen bisherigen Lebenszyklen abgeschnitten. Es hat nun keine Substanz mehr, steht aber unter Strom: Die Bilder existieren nur, weil sie die ganze Zeit mit Elektrizität massiert (oder gefoltert) werden. Das sind Metaphern zu einer Ontologie, die vielleicht einer eigenen Ruinenkunde bedarf. Nach "Zerfallspoetik" würde man eine solche von Roman Paul Widera gern lesen. BERT REBHANDL
Roman Paul Widera: "Zerfallspoetik".
Brinkmann & Bose, Berlin 2023. 88 S., Abb., br.,
24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für