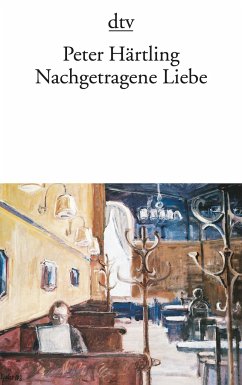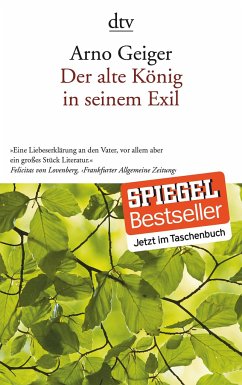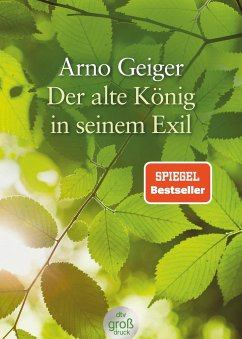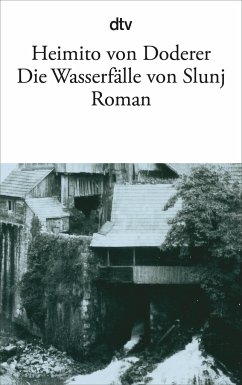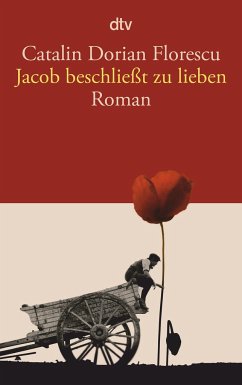Nicht lieferbar
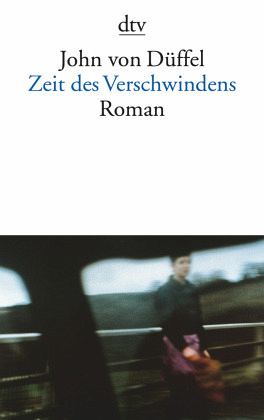
Zeit des Verschwindens
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Ein Mann ist auf dem Weg nach Hause. Sein kleiner Sohn Philipp hat Geburtstag, und er fährt Hunderte von Kilometern für diesen Tag. Doch eigentlich ist nichts in Ordnung in seinem Leben: Seine beruflich bedingte ständige Abwesenheit bestimmt seine Rolle zu Hause und zerstört das Familienleben. Jetzt will er noch einen Versuch machen, sein Kind zurückzugewinnen, Wiedergutmachung leisten für 365 versäumte Tage - »jeder einzelne unverzeihlich«. Nicht eben hilfreich ist die Erinnerung an eine ähnliche Autofahrt vor genau einem Jahr: Damals ist er einige Kilometer vor dem Ziel umgekehrt -...
Ein Mann ist auf dem Weg nach Hause. Sein kleiner Sohn Philipp hat Geburtstag, und er fährt Hunderte von Kilometern für diesen Tag. Doch eigentlich ist nichts in Ordnung in seinem Leben: Seine beruflich bedingte ständige Abwesenheit bestimmt seine Rolle zu Hause und zerstört das Familienleben. Jetzt will er noch einen Versuch machen, sein Kind zurückzugewinnen, Wiedergutmachung leisten für 365 versäumte Tage - »jeder einzelne unverzeihlich«. Nicht eben hilfreich ist die Erinnerung an eine ähnliche Autofahrt vor genau einem Jahr: Damals ist er einige Kilometer vor dem Ziel umgekehrt - aus Feigheit, aus der Befürchtung, sein Sohn könnte ihn hassen?
Christina hat vor kurzem ihre Schwester Lena durch einen Autounfall verloren. Seitdem hat sie sich ganz in sich selbst zurückgezogen. Der Versuch ihres Freundes Hendrik, sie wieder in die Welt hinauszulocken, hat fatale Folgen ...
Christina hat vor kurzem ihre Schwester Lena durch einen Autounfall verloren. Seitdem hat sie sich ganz in sich selbst zurückgezogen. Der Versuch ihres Freundes Hendrik, sie wieder in die Welt hinauszulocken, hat fatale Folgen ...