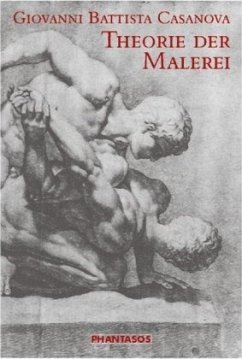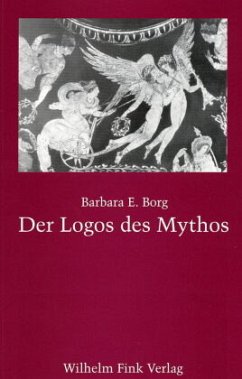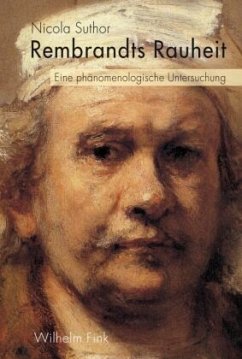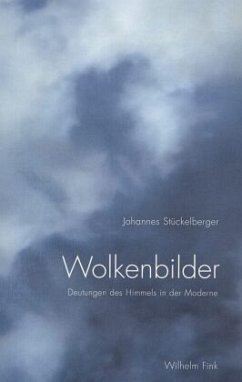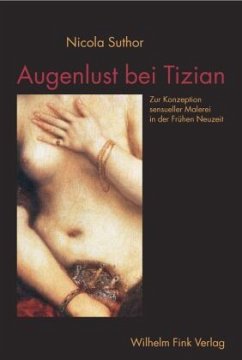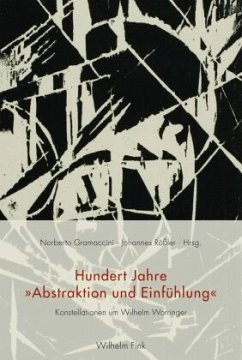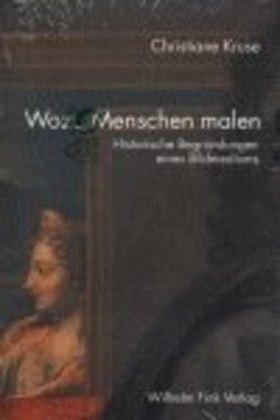
Wozu Menschen malen
Historische Begründungen eines Bildmediums. Habil.-Schr.
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
105,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Nach dem vielzitierten 'Ende der Malerei' ist es an der Zeit, ihrer Ursprünge zu gedenken. Die vorliegende Studie schreibt die Begründungsgeschichte eines alten Mediums und erschließt erstmalig umfassend antike und christliche Ursprungsmythen gemalter Bilder, näherhin deren Rezeptionsgeschichte vom Hochmittelalter bis zum Barock. Der hier zugrundeliegende Medienbegriff, der im kritischen Dialog mit den neuen Medientheorien entwickelt wird, ist semiotisch fundiert. Er dient als heuristisches Instrument, das am historischen Text- und Bildmaterial (Genesis, Inkarnation, Lukas, Vera Ikon - Nar...
Nach dem vielzitierten 'Ende der Malerei' ist es an der Zeit, ihrer Ursprünge zu gedenken. Die vorliegende Studie schreibt die Begründungsgeschichte eines alten Mediums und erschließt erstmalig umfassend antike und christliche Ursprungsmythen gemalter Bilder, näherhin deren Rezeptionsgeschichte vom Hochmittelalter bis zum Barock. Der hier zugrundeliegende Medienbegriff, der im kritischen Dialog mit den neuen Medientheorien entwickelt wird, ist semiotisch fundiert. Er dient als heuristisches Instrument, das am historischen Text- und Bildmaterial (Genesis, Inkarnation, Lukas, Vera Ikon - Narziß, Pygmalion, Medusa, Skiagraphia) erprobt wird. Auch die Traktatliteratur (von Hugo von St. Viktor bis Federico Zuccari) wird nach ihren Begründungen des gemalten Bildes befragt, wobei der diachrone Schnitt durch die Epochen die sich wandelnden Funktionen der Malerei sichtbar macht. Es wird ferner deutlich, auf welch disparate Weise Kunst- und Medienkonzepte miteinander korrelieren.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.