Autorin mit diesem Figurenentwurf auf die wachsende Zahl der Seniorinnen unter ihren Lesern. In der Epoche der Zweit- und Drittfrau aber, die, eingeleitet von Künstlern und geisteswissenschaftlichen Professoren, nun von Politikern und Unternehmern sanktioniert ist, rechnet Rosamunde Pilcher auch mit den vielen vereinsamten und enttäuschten Frauenherzen, die sich bei der Lektüre dieses Romans in den Sonnenschein des ehelichen Nachsommers, um den sie betrogen wurden, zurückträumen dürfen.
Von quälenden Feten, die der männliche Held bei der ersten Ehefrau zu überstehen hat, zum schönen Fest, das das frischgebackene Paar für sich veranstaltet, von falschem Prunk zu wahrem Segen rankt sich die Geschichte dieser beiden Junggebliebenen. Oscar, der zum späten Glück berufene Held, beginnt seine Romanexistenz in den Fängen einer temperamentvollen, steinreichen Schönheit, die durch einen Autounfall rechtzeitig zu Tode kommt. So ist, ohne Qual und Skandal, der Weg frei zur verständnisvollen Zweiundsechzigerin, die Nachsicht mit dem Sonderling übt und wie durch ein Wunder zu gerade so viel Geld kommt, daß es für ein Häuschen reicht, in dem sie sich mit ihm einquartiert. Lichterglänzend und duftdurchströmt gestaltet sie ihm ein Weihnachtsfest, gerade so, wie er es braucht. Zum Fest des "Heiligen Kindes" gelingt es ihr noch dazu, ihm - zum Ersatz für seine mit der Mutter umgekommene Tochter - eine neue Ziehtochter zuzuführen. Der Beglückte ist zwar ein etwas eigenbrötlerischer Träumer, um so mehr beweist die Gelassenheit, mit der die neue Lebensgefährtin ihn zu handhaben weiß, was eine reife Frau für einen Mann wert sein kann. Den sitzengebliebenen zweiundsechzigjährigen Leserinnen mag das ein Trost sein.
Verwunderlich ist an Rosamunde Pilcher nicht der Spürsinn, der ihr sagt, was so viele Frauen heute brauchen, sondern der Leichtsinn, mit dem sie ihre Chance an die Langeweile verschenkt. Die Schreiberhand, mit der sie die Salbe auf die Seele aufträgt, ist müde. Das Buch scheint mit einem Leser zu rechnen, der Zeit hat und durch keine Besonderheiten festgehalten werden muß. Freilich trifft das für verlassene Ehefrauen zu.
Der angelsächsische Roman bevorzugt das Gespräch vor der Erzählung. Er versucht, die mündliche Rede so wiederzugeben, als finde sie gerade statt, mit all den Beiläufigkeiten, wie sie im Leben vorkommen. Wer aber möchte solch ein Gespräch lesen müssen: "Ich soll dir meinen alten Fernseher leihen. Willst du den haben? / Hast du einen? / Klar. / Das wäre natürlich toll, aber ich komm auch ganz gut ohne aus. / Ich check ihn mal durch." Rosamunde Pilcher übt diese Taktik bis zum Exzeß. Tunlichst vermeidet sie Beschreibungen. Wenn ein Ambiente vorgestellt werden muß, kommt eine Freundin daher, die durchs Haus schreitet und jedem Einrichtungsgegenstand nachfragt, wo der Kühlschrank, wo Bett und Vorhang seien, nur damit die Gastgeberin durch direkte Rede Standplatz und Aussehen beschreiben kann. Auch haben die beiden unbeschäftigten Freundinnen genug Zeit, um sich klar darüber zu werden, wo ein Auto zu parken, der Hund zu schlafen habe, ob eine Tasse Tee getrunken und diese lieber mit oder ohne Milch genommen werde. Jedes "Hmm" kommt der Autorin gelegen.
Trotz der Herzenswärme, die solch monosyllabische Äußerungen enthalten, machen sie deutlich, daß sich ein Menschenleben, im Roman wie in der Wirklichkeit, nach dem zweiundsechzigsten Lebensjahr in die Länge ziehen kann.
HANNELORE SCHLAFFER
Rosamunde Pilcher: "Wintersonne". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Ursula Grawe. Wunderlich Verlag, Tübingen 2000. 767 S., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
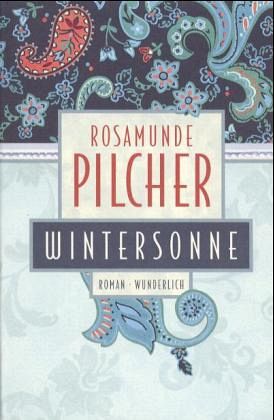



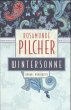


 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.10.2000
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.10.2000