Aber der junge Organist quält sich mit Händel, mit dem Einfachsten der Welt, mit dem Tod.
Das ist erstaunlich und mutig: Ein junger Autor rückt die Vergänglichkeit ins Zentrum eines Buches. Noch erstaunlicher aber ist, daß es sich bei diesem Buch um eine christliche Gottsuche handelt. Jan Lurvink stellt die alten Fragen: Kann ich hoffen? Was darf ich hoffen? Die Suche nach einer Antwort bewegt sich zwischen dem dunklen Karfreitagschristentum, dessen Gott auf Erden sterben mußte, und der frohen, österlichen Botschaft.
Leise ironische Friedhofsszenen, Episoden vom Arbeitsplatz des Erzählers bilden den Rahmen, ebenso wie Rückblenden auf den Werdegang zum Musiker. Der beginnt in der öffentlichen Musikschule und führt schon bald zum kauzigen Dorforganisten: "Es gibt nur zwei Weisen in der Musik: die Andacht oder den Tanz. Auf dem Klavier wird getanzt und den Weibern unter die Röcke geschunkelt. Wirkliche Musik aber ist eine Gabe Gottes! Eine Gabe Gottes!" Erst auf dem Konservatorium begreift der Erzähler den Ernst der Sache. Dort packt ihn eine Musik, die die Schöpfung nachzeichnet, Bachs Musik, die in ihrer mathematischen Ordnung ein Gleichnis der biblischen Botschaft ist.
Um diese Botschaft, mit ihren Widersprüchen ringt der Ich-Erzähler. Dabei streift er die aus der christlichen Mode gekommene Frage nach dem Gericht, nach der Verdammnis, nach dem strafenden Gott und wundert sich über Kanzelworte, die stets mit der Auferstehung beginnen. Vom Jüngsten Gericht war in der religiösen Literatur lange nicht die Rede. Auch hier beweist der dreiunddreißigjährige Autor mit seinem ersten Buch Mut und Entschlossenheit. Zudem wendet er sich mit Vehemenz gegen die übliche gesellschaftspolitische Ausdeutung des Christentums, hat kein Interesse an Jesus als neuem Mann und findet lila Tücher läppisch. Er kehrt zurück zu den einzelnen Seelen ihrer Angst: "Denn wenn man liebte oder im Sterben lag, wenn man verzweifelt war oder noch ein Kind, dann war die Gesellschaft nichts als ein ferner Spuk." Jan Lurvink will keine Sozialworte hören, er pocht an die Tore der Metaphysik.
Dabei hilft ihm die Orgel, dieses Instrument mit dem langen Atem, der durch die Windladen strömt, sich in den kleinen und großen Pfeifen bricht. Mit ihrem Luftstrom und ihrer Stimmvielfalt, die ein ganzes Orchester ersetzt, atmet sie christlichen Geist. Immer wieder geht der Erzähler in die Kirche und übt, verspielt sich, beginnt von neuem, fragt sich: "Wie schnell spiel ich's nur? Wo beton ich's denn?" Der Orgellehrer des Konservatoriums sitzt in eine Wolldecke gehüllt bei seinem Schüler und erklärt den Notentext, die Noten als Zeichen und Winke. Oder er wandert über die Empore und spricht über das Leben als Gottesdienst. Nicht nur die Musik und ihr Instrument verweisen bei Jan Lurvink auf die Tanszendenz, aber sie sind es, die in diesem Buch ein neues, sehr altes Kunstverständnis begründen. Erst Gott, dann die Musik, dann der Künstler.
Dem Verlag scheint das eher unangenehm zu sein, denn er setzt dem heteronomen Motto des Organisten, "an ihr, der Orgel, soll er wirken, nicht an seinem Bilde", im Schutzumschlag des Buches ein stilisiertes Bild des Autors entgegen. Im Großformat, in Postergröße, nicht Jesus Christus, nicht Bach, sondern Lurvink. Auch gegen die offenkundige große Nähe von Erzähler und Autor hat der Verlag durch die beherzte Gattungsbezeichnung "Roman" das seinige getan, um den Verdacht, es handele sich hier um einen religiösen Bekenntnistext, zu zerstreuen. Die Konzentration eines jungen Autors auf religiöse Fragen rührt wohl an eines der letzten Tabus der Gegenwartsliteratur, das zeigt auch der Klappentext, der den Werdegang eines Musikers und die Entdeckung der "verstörenden zeitgenössischen Musik" ankündigt, am Rande auf den "allgegenwärtigen Tod" verweist, die Religion aber ganz einfach verschweigt.
Den Autor sollte das nicht bekümmern, denn er hat etwas zu sagen, mit großem Ernst und einer eigenen Sprache. Immer wieder wird der ungewohnt hohe Ton der religiösen Reflexion durch Alltagssprache aufgefangen. Nicht selten dienen Kontraste und Ironisierungen einer Distanzierung, die angenehm von der Selbstinszenierung anderer junger Autoren abweicht - Jan Lurvink hat keine Home-Page. Allenfalls die zahlreichen Wortspiele und etwas gewagten Verben stören den Sprachfluß, der im Laufe des Buches an Ruhe gewinnt. Besonders dort, wo es um den Tod geht, findet Lurvink unprätentiöse Bilder: "Der Krematoriumarbeiter hat sich seinen Mundschutz übergezogen und zerkleinert mit einem Stößel die zu großen Knochenteile, damit die Mahlmaschine später nicht verklemmt. Notfalls liest er aus dem Aschezuber die künstlichen Hüftgelenke heraus; klar, daß die sich nicht in den Wind streuen lassen." SANDRA KERSCHBAUMER
Jan Lurvink: "Windladen". Roman. Dumont Verlag, Köln 1998, 190 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
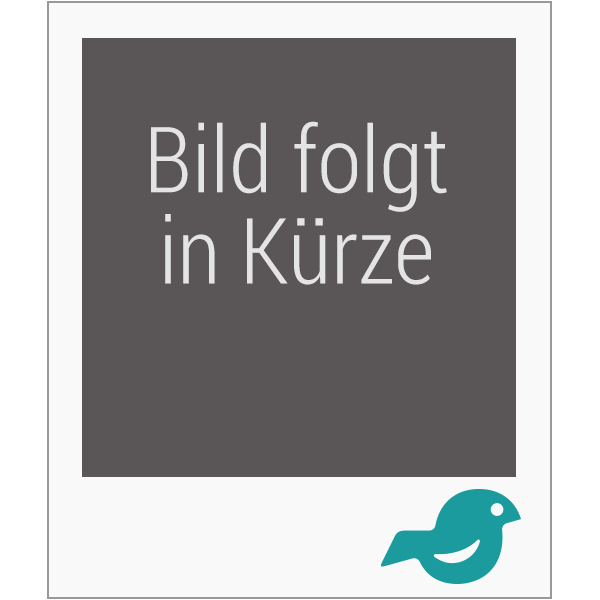




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.02.1999
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.02.1999